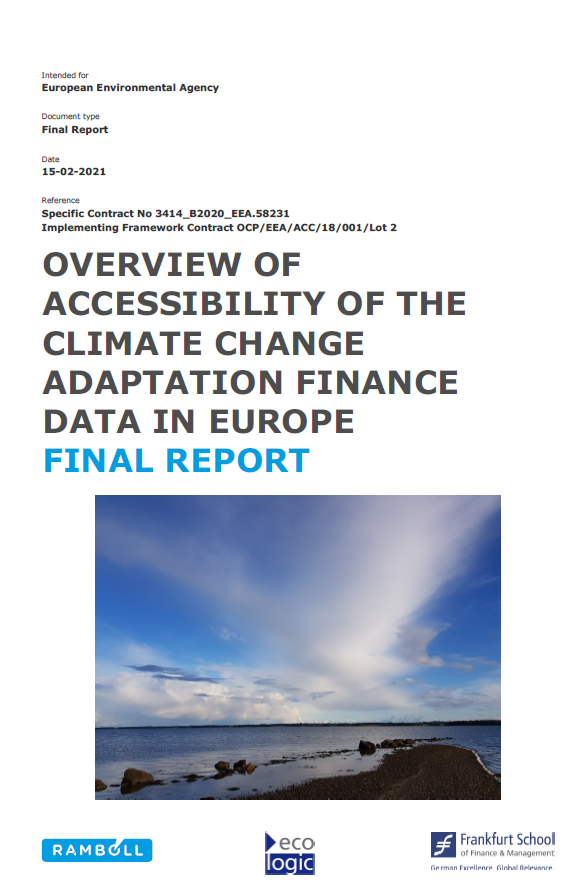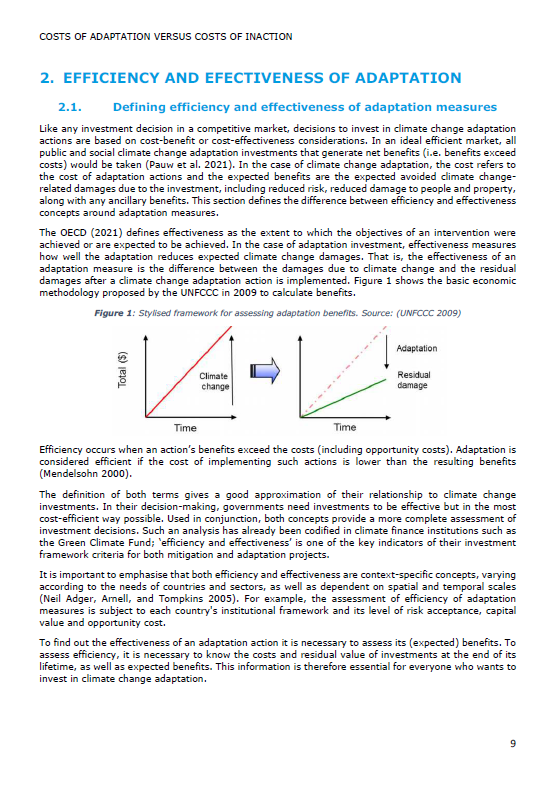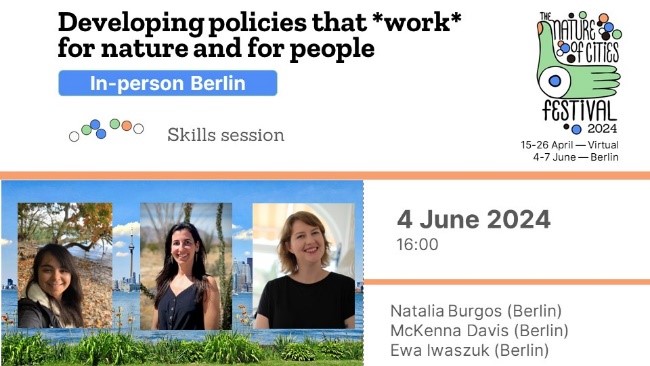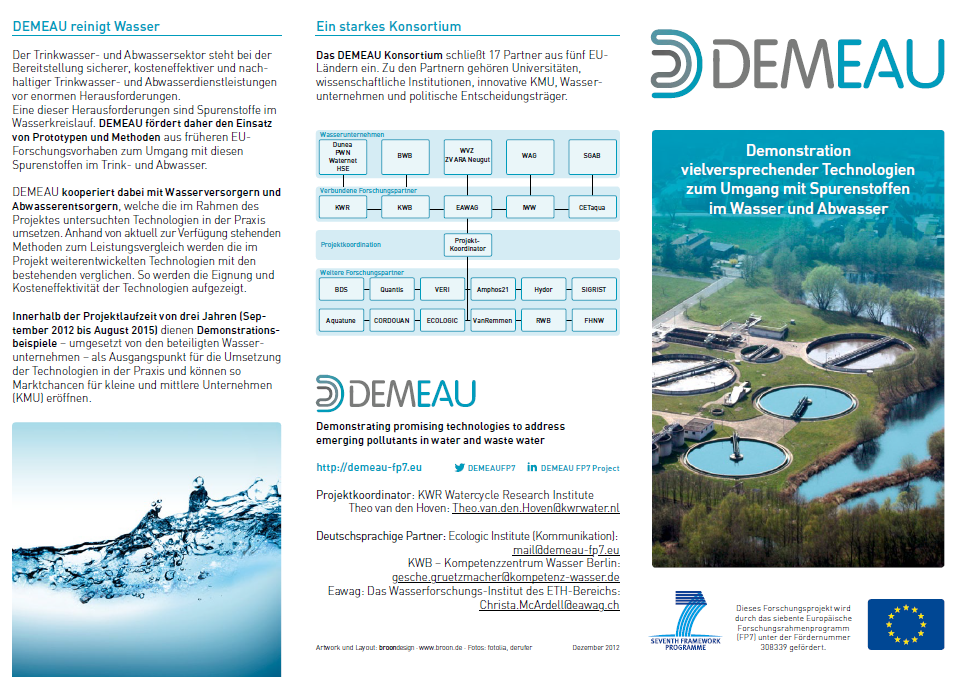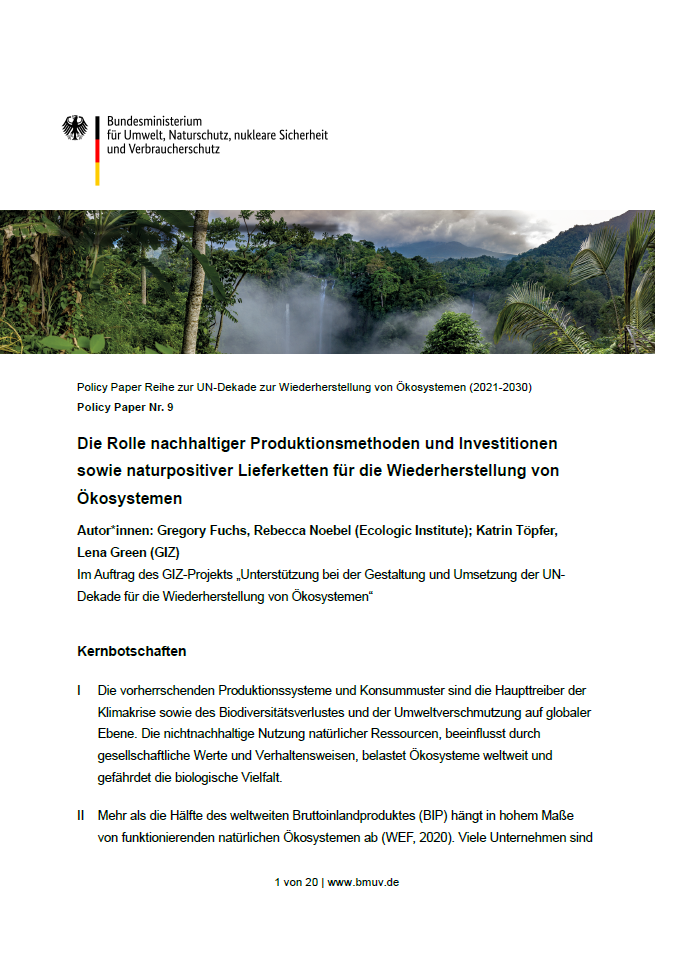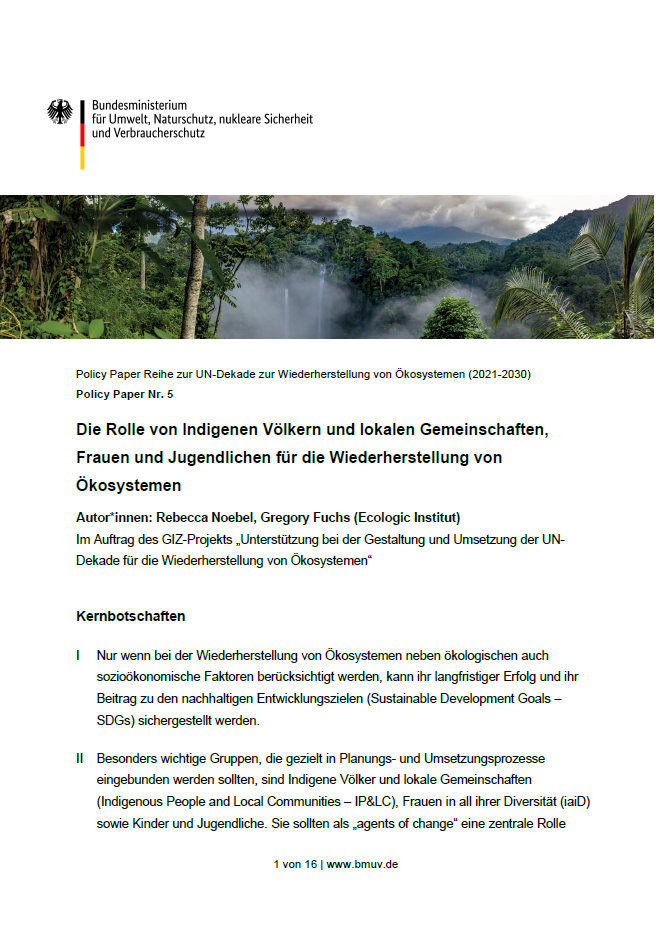Publikation:Bericht
Publikation:Bericht
Veranstaltung:Konferenz
The Nature of Cities Festival 2024
Ecologics Spotlight: Urbane Zukünfte begrünen
-
virtuell und Berlin,
Deutschland
Präsentation:Podiumsdiskussion
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Natürlich resilient
Naturbasierte Lösungen in kommunalen Klimaanpassungskonzepten verankern
online
Präsentation:Vortrag
Zusammenstellung bestehender Leitlinien zur Wiederherstellung von Ökosystemen
Dr. Benjamin Kupilas
Veranstaltung:Workshop
Webtool Prototypenprüfung im AMAREX-Projekt
2. Stakeholder Workshop
-
Berlin und Köln,
Deutschland
Publikation:Flyer
Präsentation:Podiumsdiskussion
Präsentation:Vorlesung
Projekt
Auswirkungen des Klimawandels auf Wasser und Gesundheit
Der Klima-Wasser-Gesundheit-Nexus
-
WeiterlesenVeranstaltung:Konferenz
Urbane Räume neu denken
Naturbasierte Lösungen für integrative Transformationen in Europa und Lateinamerika
-
Granollers,
Spanien
Publikation:Policy Brief