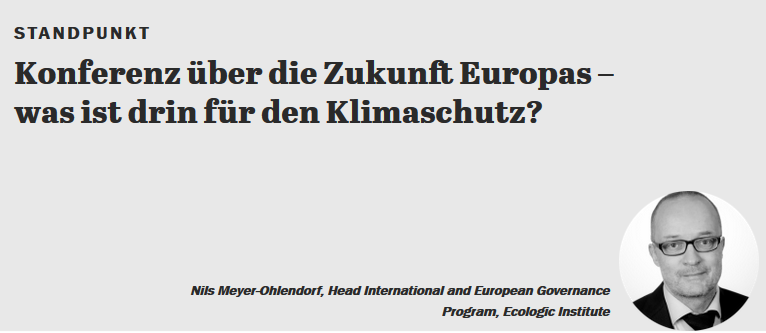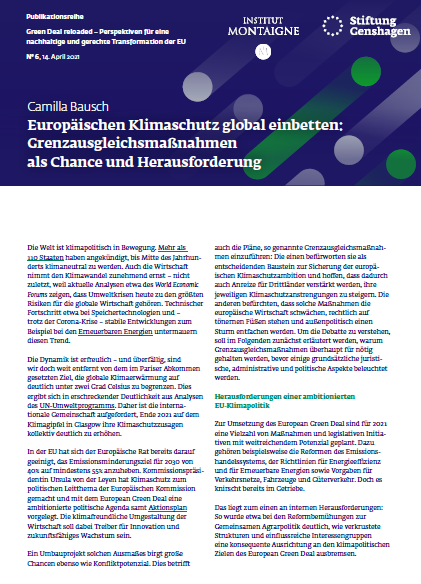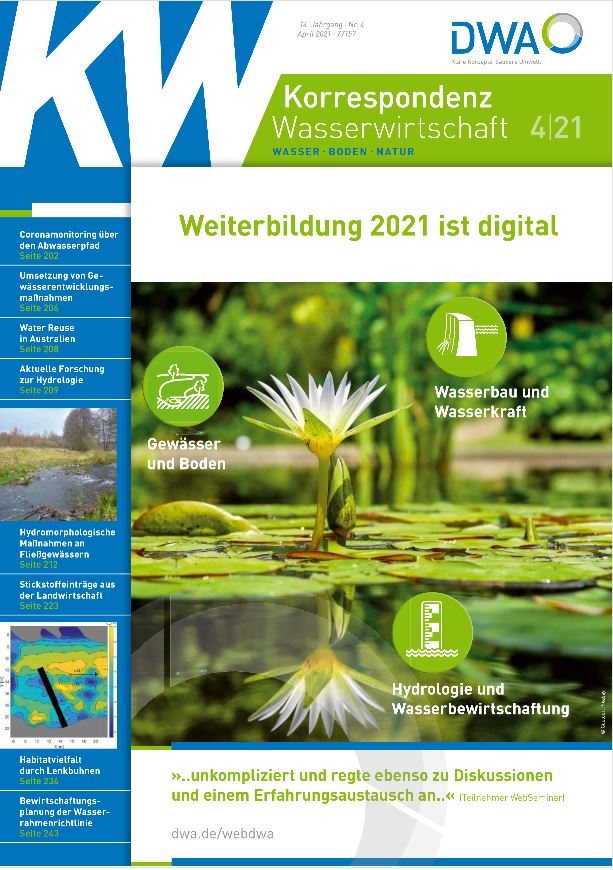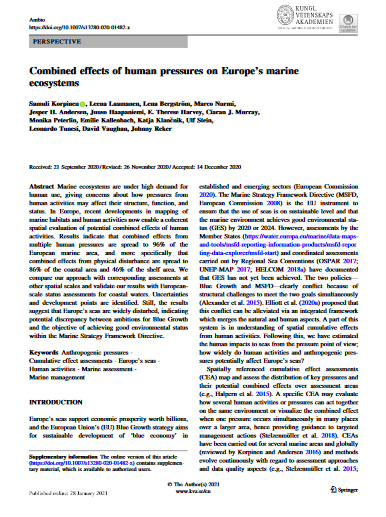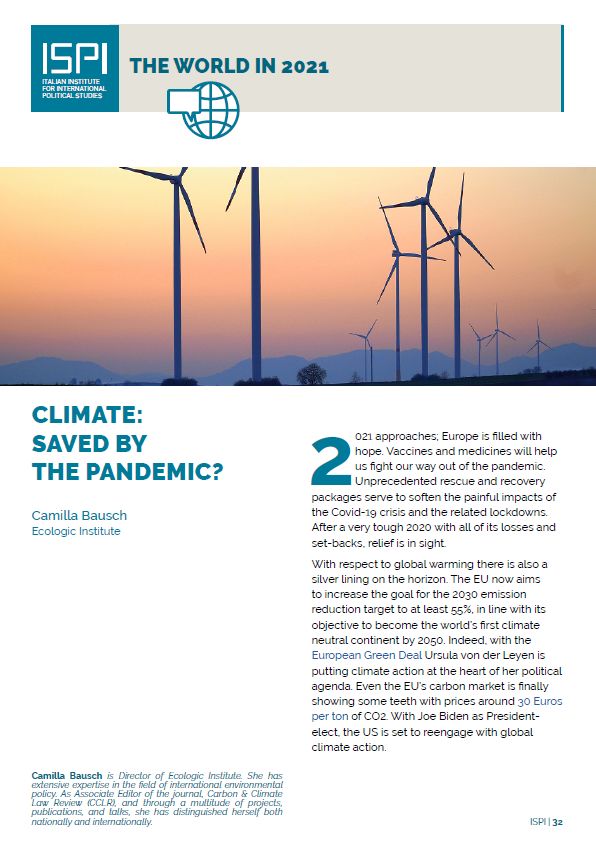Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Nature-Based Solutions and Sustainable Urban Planning in the European Environmental Policy Framework
Analysis of the State of the Art and Recommendations
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Europäischen Klimaschutz global einbetten
Grenzausgleichsmaßnahmen als Chance und Herausforderung
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Transitioning out of Open Access
A Closer Look at Institutions for Management of Groundwater Rights in France, California, and Spain
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Climate: Saved by the pandemic?
Beitrag von Dr. Camilla Bausch zur ISPI Publikation "Die Welt in 2021"
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Deutschland, der Multilateralismus und die Klimakrise
Wie Kooperationen die Klimapolitik stärken können
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel