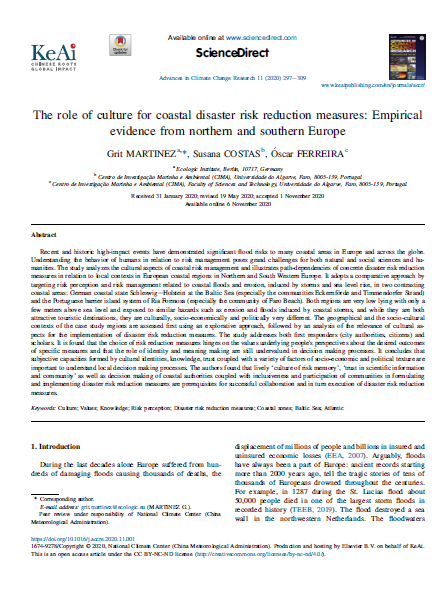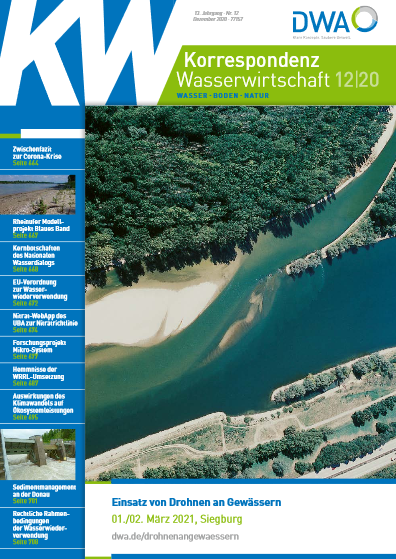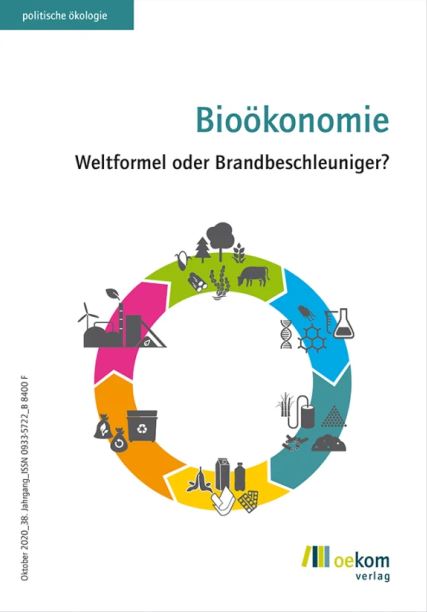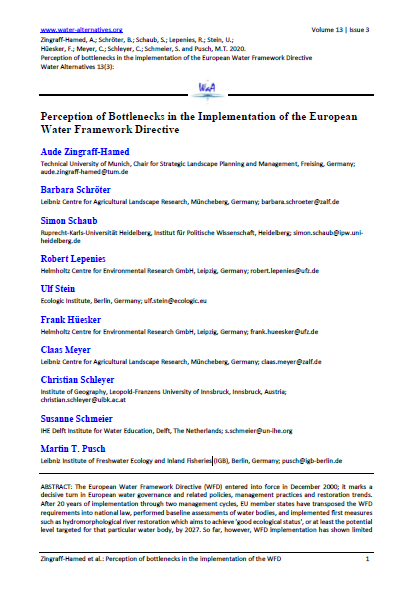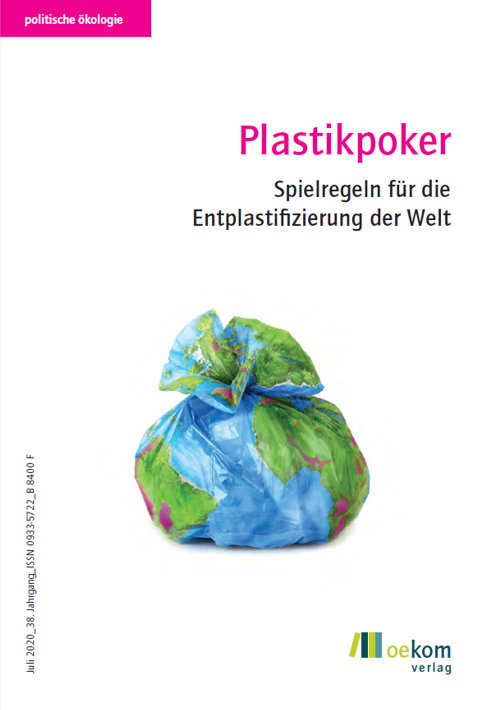Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
The Role of Culture and Informal Aspects for Coastal Disaster Risk Reduction Measures
Empirical Evidence from Northern and Southern Europe, Advances in Climate Change Research
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
Handlungsoptionen einer nachhaltigen Bioökonomiepolitik
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
Koordination in der Governance von Flussgebieten in Südspanien stärken
Kooperation, Anreize und Überzeugungsarbeit
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
From State to User-based Water Allocations
An empirical analysis of institutions developed by agricultural user associations in France
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel