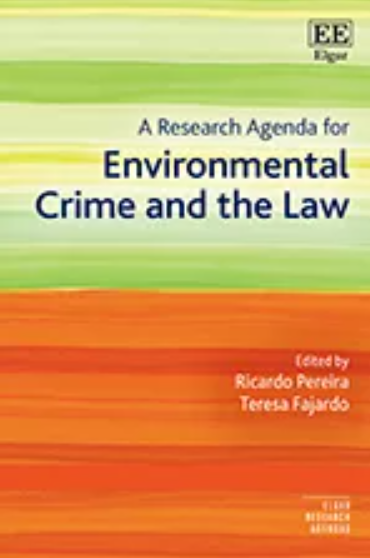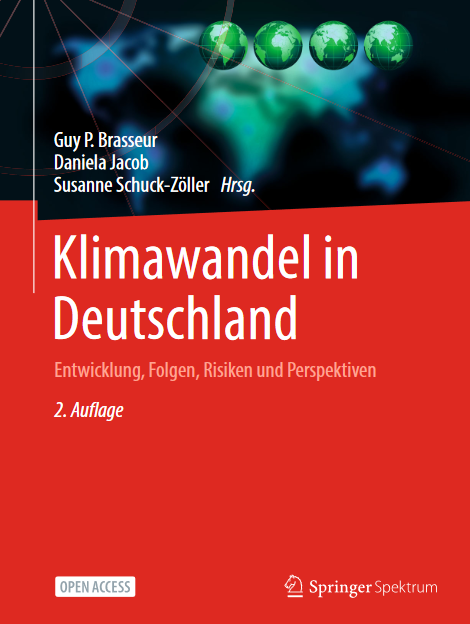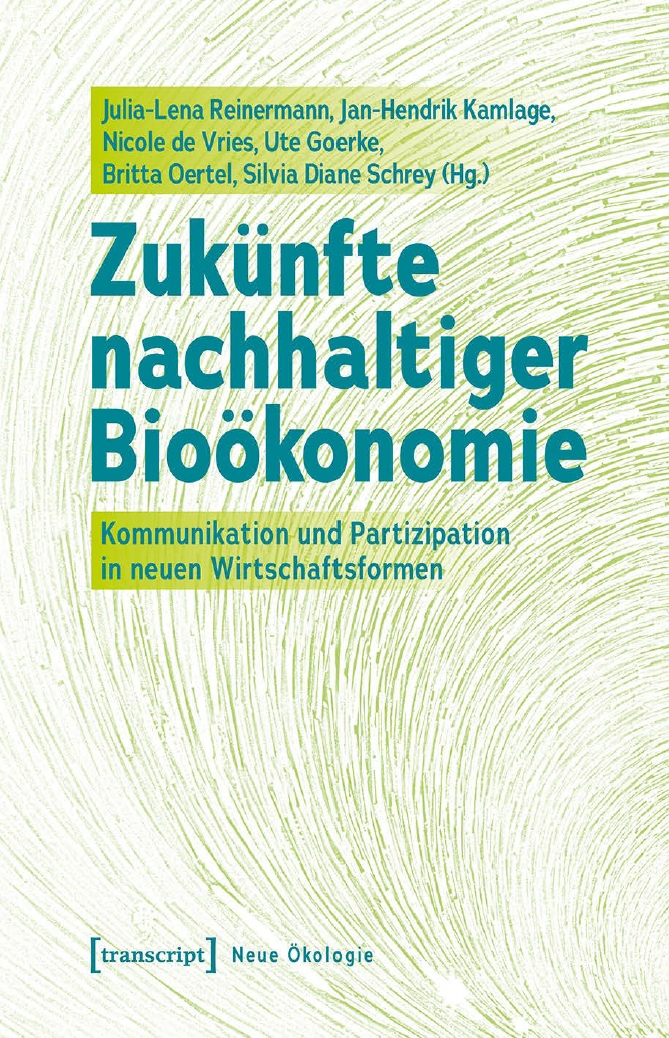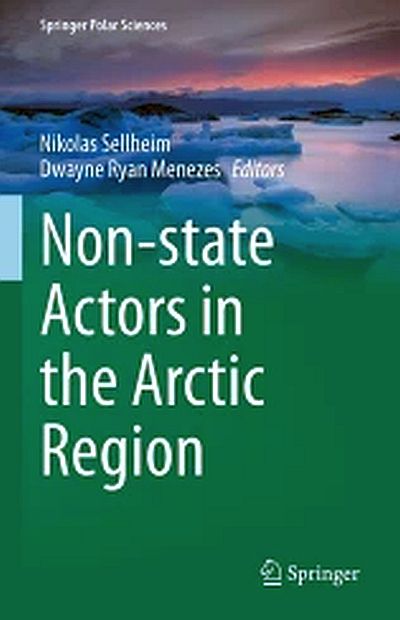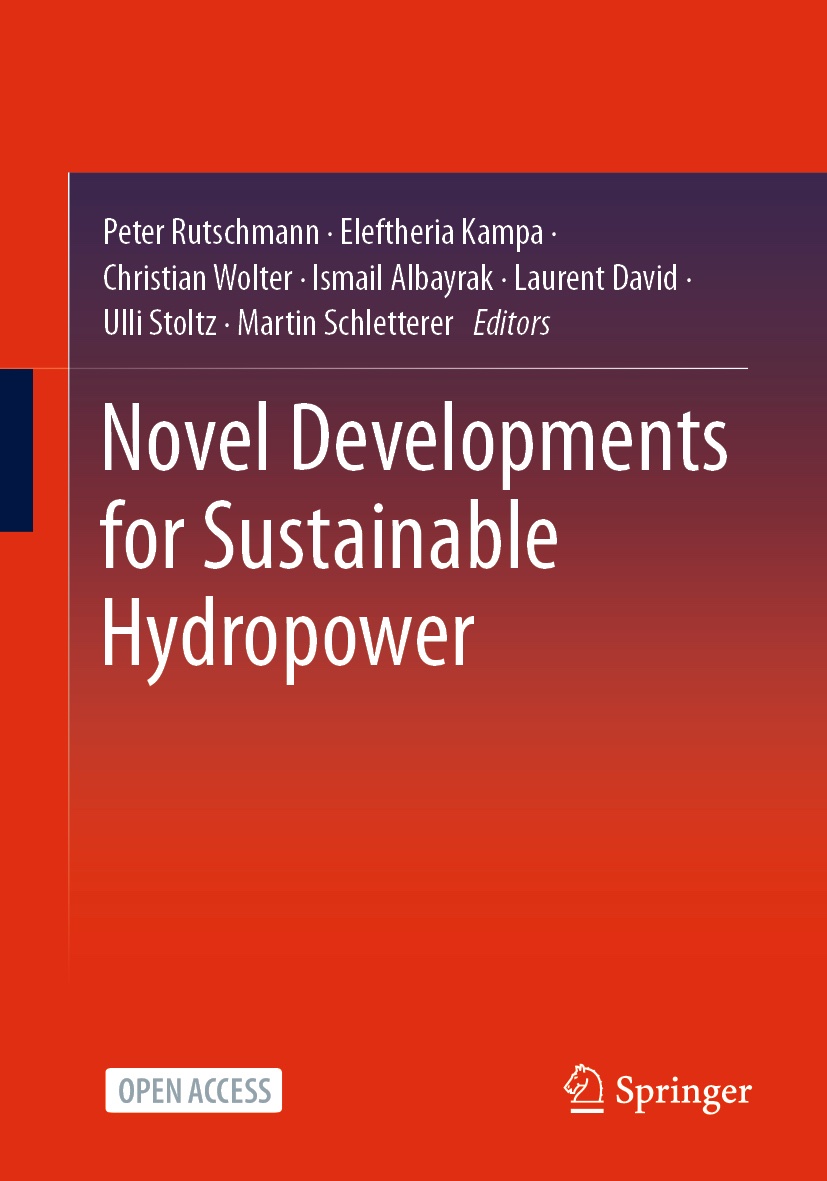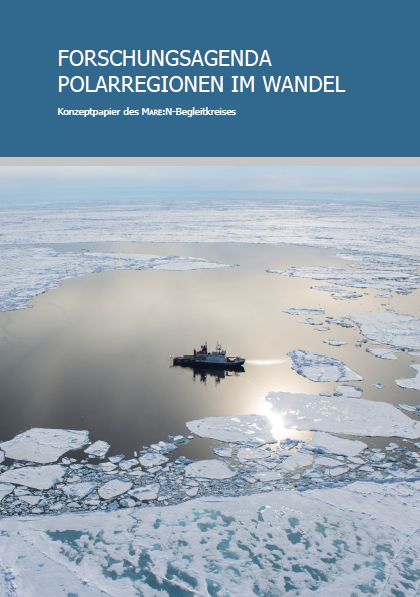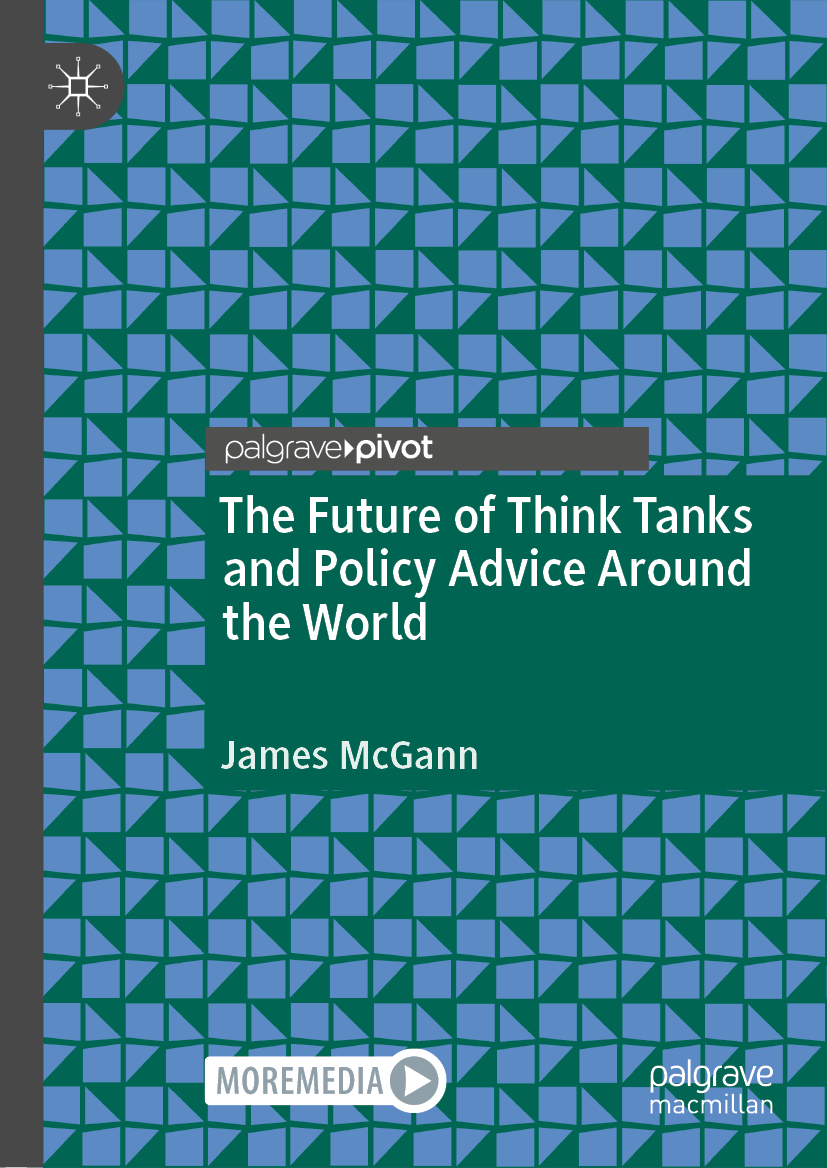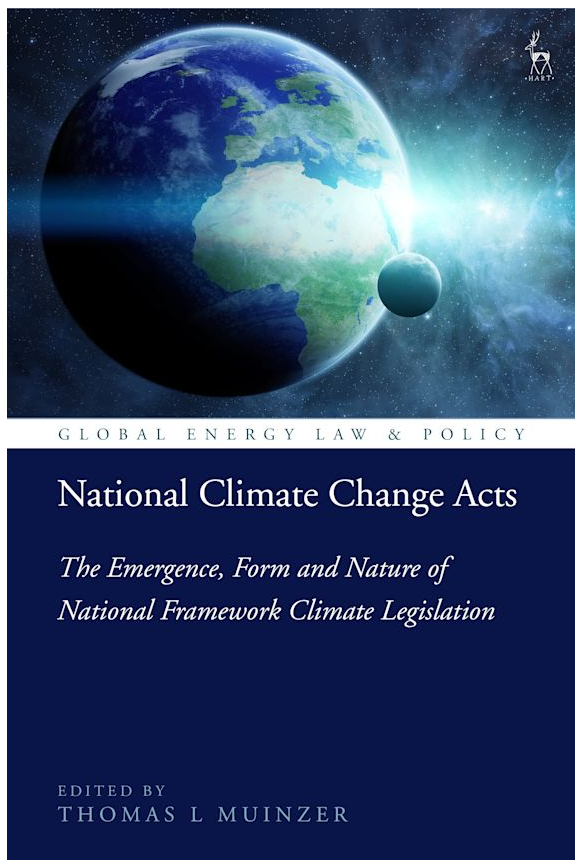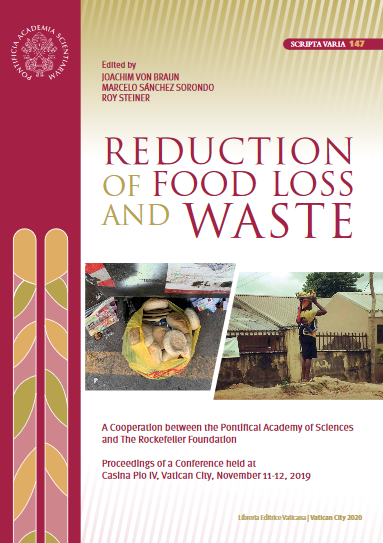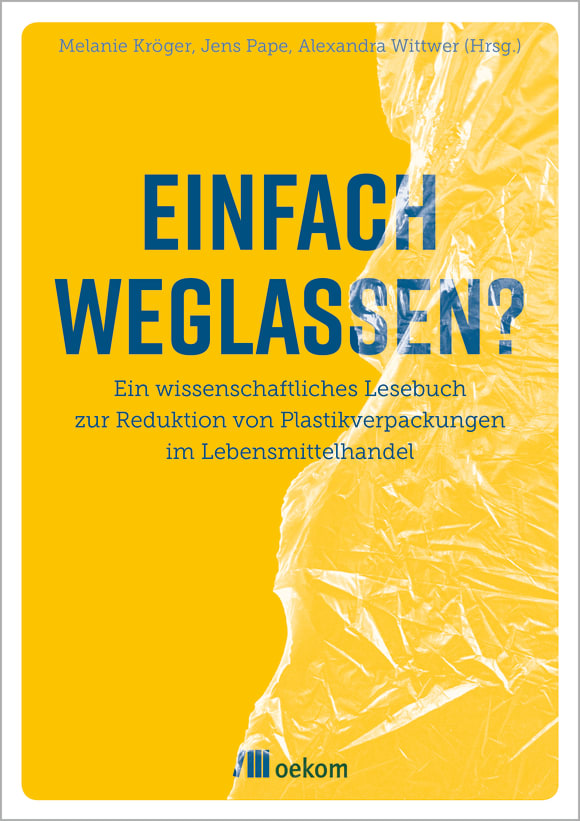Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Climate Change and Criminal Justice
Kapitel in "A Research Agenda for Environmental Crime and the Law"
Jahr
WeiterlesenPublikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
'Paris Compatible' Climate Change Acts?
National Framework Legislation in an International World
Jahr
WeiterlesenPublikation:Buchkapitel
Publikation:Buchkapitel
Umweltproblem Plastikverpackung
Aufkommen in Deutschland und Auswirkungen auf die Umwelt
Jahr
WeiterlesenPublikation:Buchkapitel