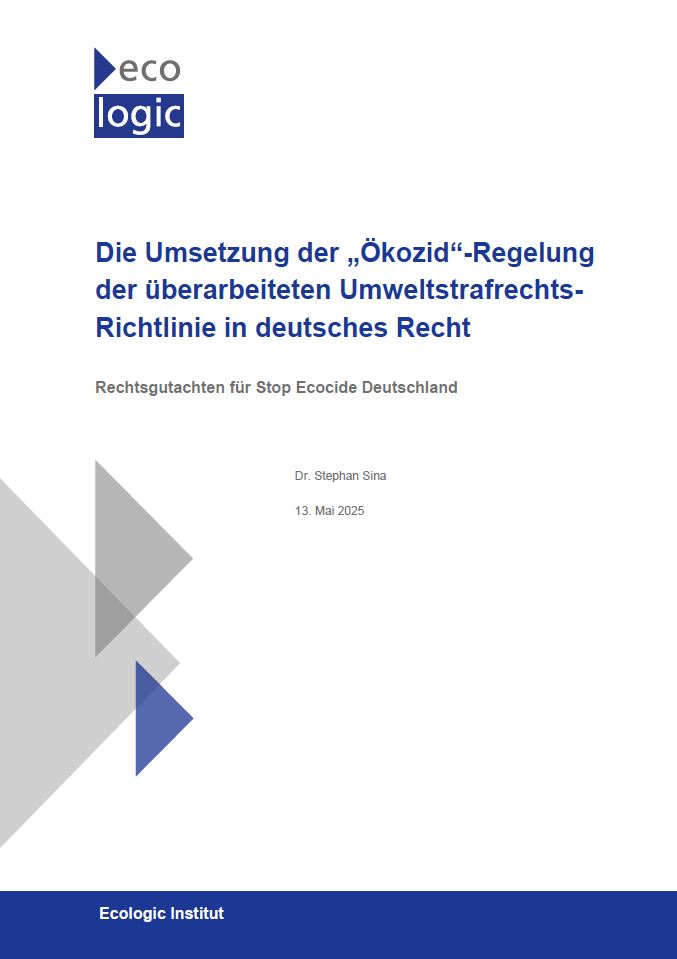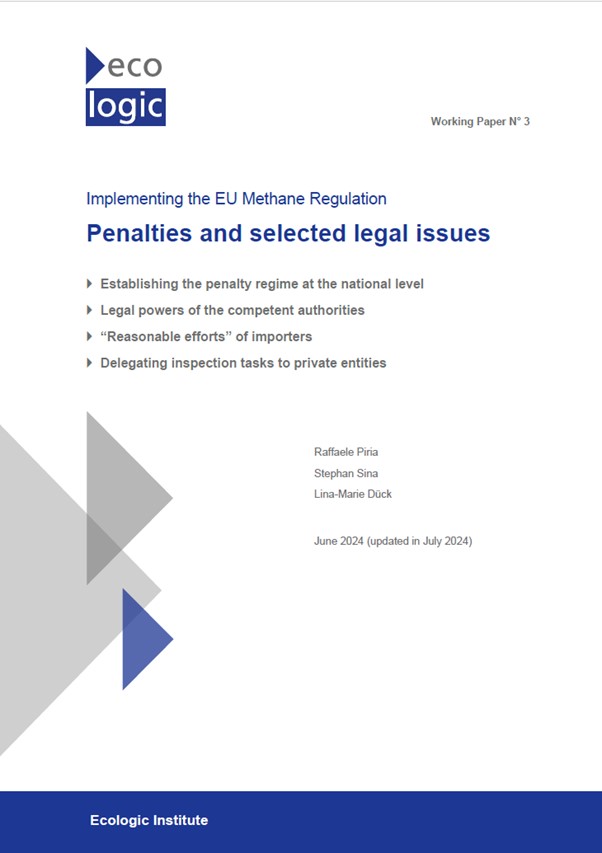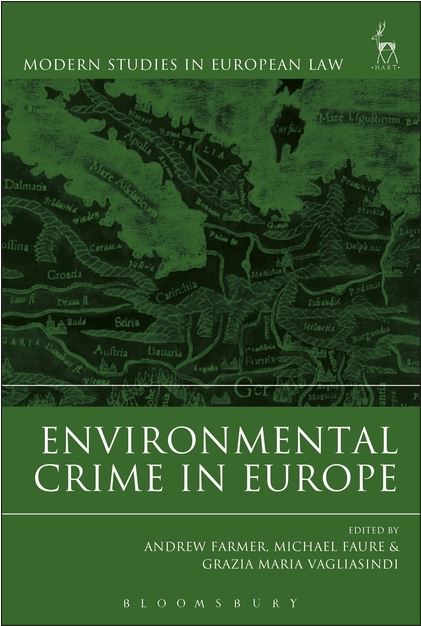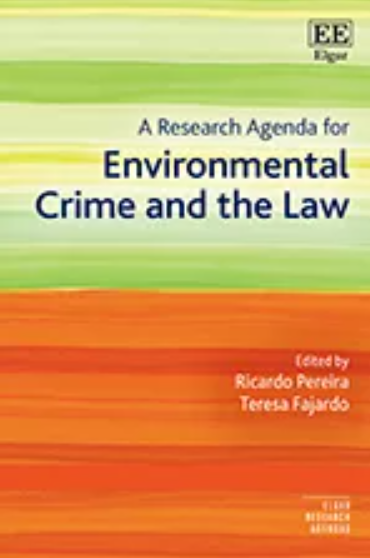
© EE Elgaronline, 2025
Climate Change and Criminal Justice
Kapitel in "A Research Agenda for Environmental Crime and the Law"
- Publikation
- Zitiervorschlag
Sina, Stephan (2025): Climate Change and Criminal Justice. In: Pereira, Ricardo / Fajardo, Teresa (eds.): A Research Agenda for Environmental Crime and the Law. Cheltenham (UK), Northampton/Massachusetts (USA): Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781803929958
Im Rahmen des Abschnitts über neue und aufkommende Themen im Buch "A Research Agenda for Environmental Crime and the Law" steuerte Stephan Sina, Senior Fellow am Ecologic Institut, ein Kapitel mit dem Titel "Klimawandel und Strafrecht" bei. In diesem Kapitel untersucht er, warum das Strafrecht bislang nur eine untergeordnete Rolle in der Diskussion um Klimaschutzmaßnahmen spielt – und ob sich das ändern sollte und könnte.
Seine Analyse der Durchsetzung von Klimaschutzverpflichtungen zeigt, dass weder das europäische Recht noch die nationalen Rechtssysteme der Mitgliedstaaten grundsätzlich eine strafrechtliche Sanktionierung von Verstößen gegen klimaschützende Gesetze verlangen. Dennoch gibt es überzeugende Argumente dafür, schwerwiegende Verstöße gegen solche Gesetze unter Strafe zu stellen. Eine zentrale Herausforderung besteht allerdings darin, dass individuelle Treibhausgasemissionen in der Regel nur einen sehr geringen Einfluss auf den Klimawandel haben, was die Feststellung erschwert, welche Verstöße als schwerwiegend einzustufen sind. Diese Problematik stellt sich nicht bei Straftaten, die lediglich im Zusammenhang mit Klimaschutzverpflichtungen begangen werden, wie etwa bestimmten Finanzdelikten . Sina legt nahe, dass das Strafrecht derzeit zwar nur eine ergänzende Rolle bei der Durchsetzung von Klimaschutzpflichten spielt, sich nach erreichter Klimaneutralität jedoch zu einem eigenständigeren Instrument entwickeln könnte.
Der von Ricardo Pereira (Cardiff University) und Teresa Fajardo (Universität Granada) herausgegebene Band „A Research Agenda for Environmental Crime and the Law“, erschienen bei Edward Elgar, umfasst 14 Kapitel, die ein breites Spektrum umweltstrafrechtlicher Themen abdecken. Behandelt werden unter anderem Forschungsmethoden, Ökozid-Normen, Biodiversitätsdelikte, illegaler Wildtierhandel, Tierrechte, die Durchsetzung des Umweltstrafrechts, künstliche Intelligenz sowie internationale Institutionen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Umweltkriminalität.