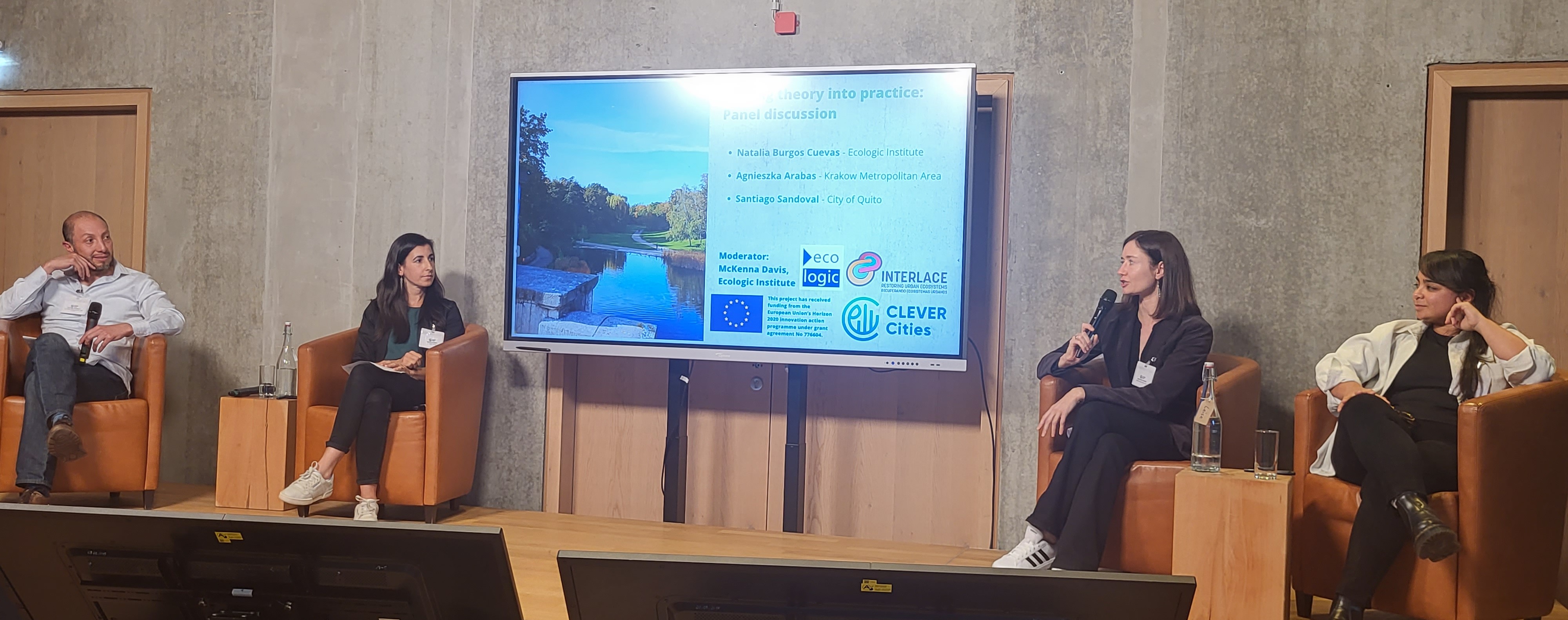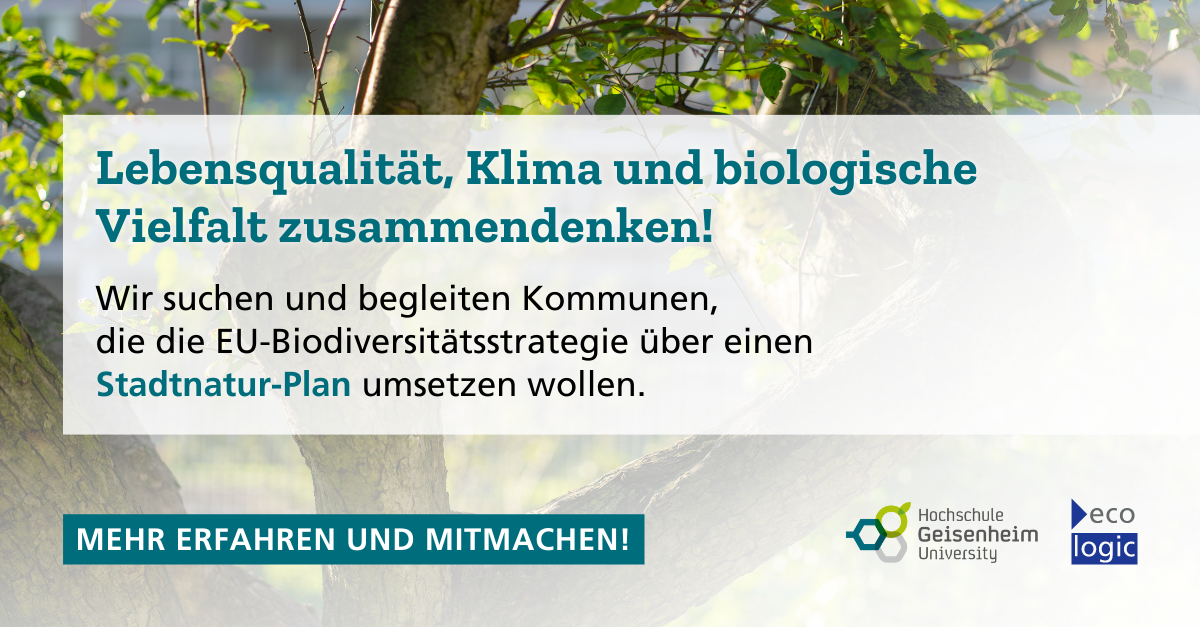Präsentation:Vortrag
Präsentation:Vorlesung
News
Gemeinsame Erklärung der Konferenz "Power to the Peatlands" – 19. bis 21. September 2023
Jetzt Natur, Klima und Zukunft stärken!
Weiterlesen
Veranstaltung:Workshop
Wie kann der Anbau von Tiefwurzlern gefördert werden?
Hessische Staatsdomäne Frankenhausen,
Deutschland
Präsentation:Vortrag
Präsentation:Moderation
Veranstaltung:Workshop
Praxisforum: Klimaanpassung vor Ort
Politische und rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten für naturbasierte Lösungen in Kommunen
Berlin,
Deutschland
Veranstaltung:Konferenz
Auswirkung des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit
WADKlim-Abschlusskonferenz
Berlin,
Deutschland
Veranstaltung:Workshop
Maßnahmen zur Erhöhung der Klimaresilienz von Gewässern und des Landschaftswasserhaushalts
2. KliMaWerk Stakeholder Workshop
Wesel,
Deutschland
Präsentation:Vortrag
Veranstaltung:Konferenz
News
News
Präsentation:Moderation