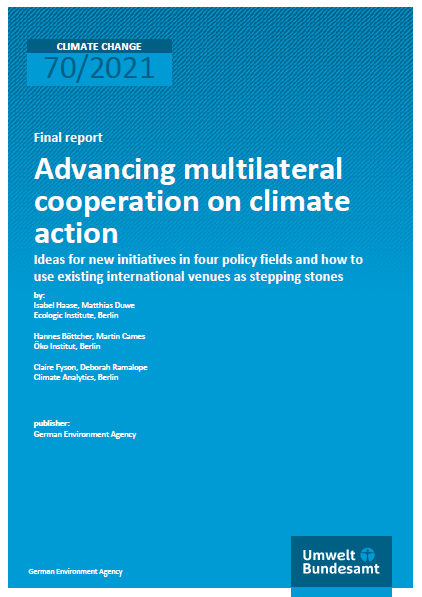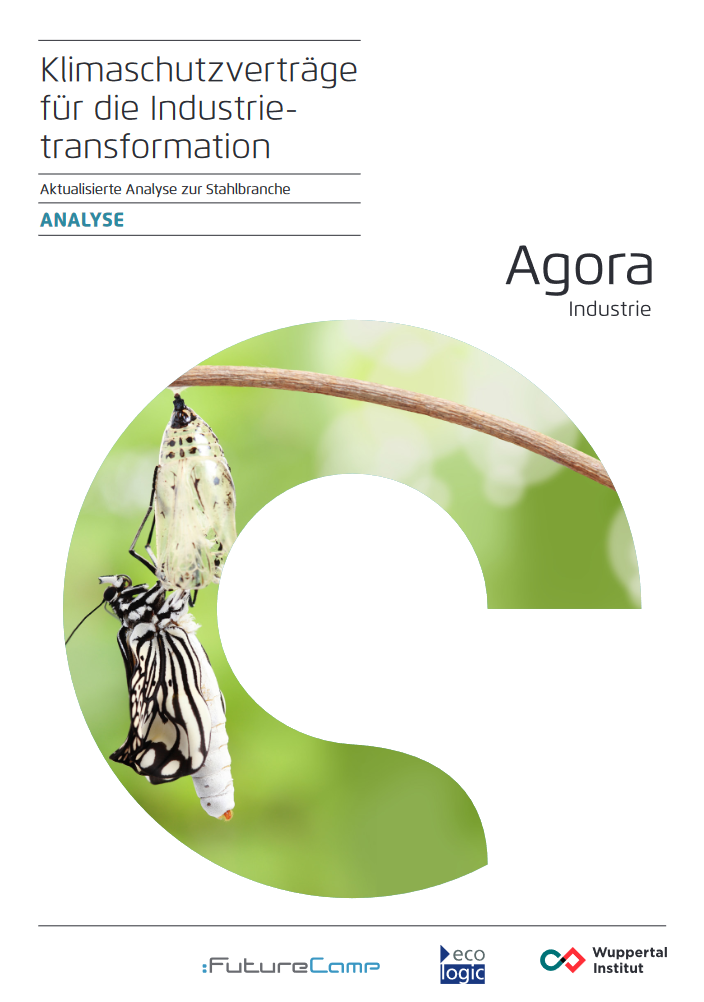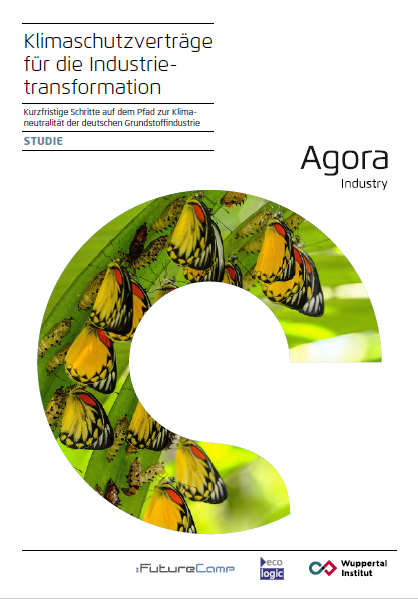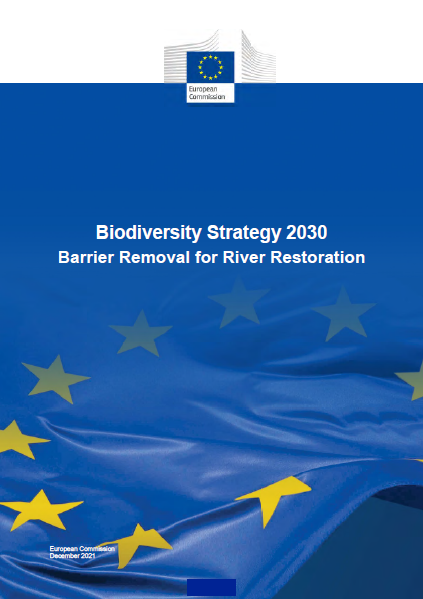Projekt
Publikation:Bericht
Advancing Multilateral Cooperation on Climate Action
Ideas for new initiatives in four policy fields and how to use existing international venues as stepping stones
Jahr
WeiterlesenPräsentation:Interview
Publikation:Artikel
Effects of Policy and Functional (In)coherence on Coordination
A comparative analysis of cross-sectoral water management problems
Jahr
WeiterlesenPublikation:Bericht
Publikation:Bericht
Klimaschutzverträge für die Industrietransformation
Kurzfristige Schritte auf dem Pfad zur Klimaneutralität der deutschen Grundstoffindustrie
Jahr
WeiterlesenPräsentation:Vortrag
Publikation:Infografik
Publikation:Knowledge for Future – Der Umwelt-Podcast
Gutes Essen für alle! Ernährungswende – Regional Gedacht (4/4)
13. Folge von "Knowledge for Future – Der Umwelt-Podcast"
Jahr
WeiterlesenPublikation:Knowledge for Future – Der Umwelt-Podcast
Vom Acker auf den Teller – Ernährungswende – Regional Gedacht (3/4)
12. Folge von "Knowledge for Future – Der Umwelt-Podcast"
Jahr
WeiterlesenPublikation:Konferenzpapier
Online-Expert*innenworkshop am 30.11.2021 "Ziele und Indikatoren für die Proteinwende in Deutschland"
Ergebnisdokumentation
Jahr
WeiterlesenPublikation:Konferenzpapier
Ziele und Indikatoren für die Proteinwende in Deutschland
Inputpapier für den STErn Expert*innenworkshop am 30. November 2021
Jahr
WeiterlesenVeranstaltung:Digitale Veranstaltung
Publikation:Bericht