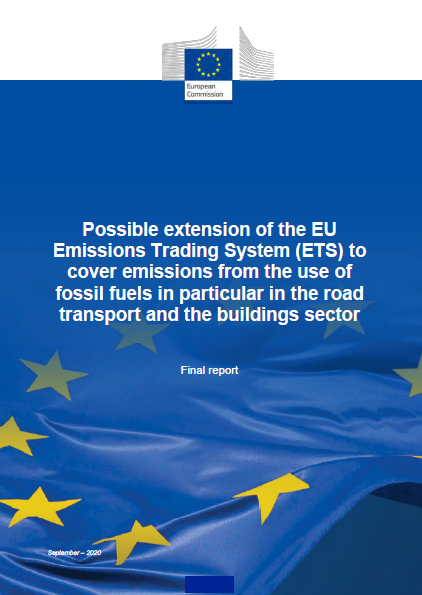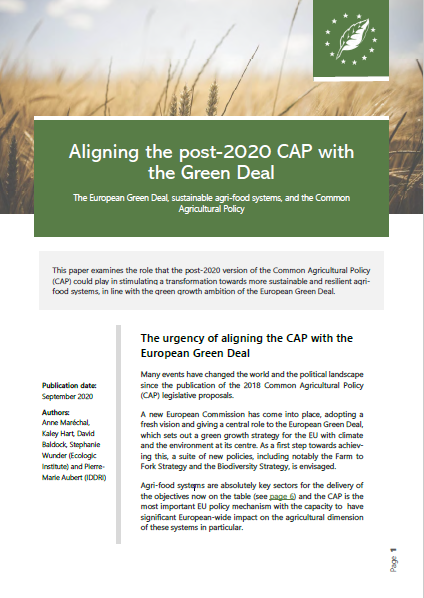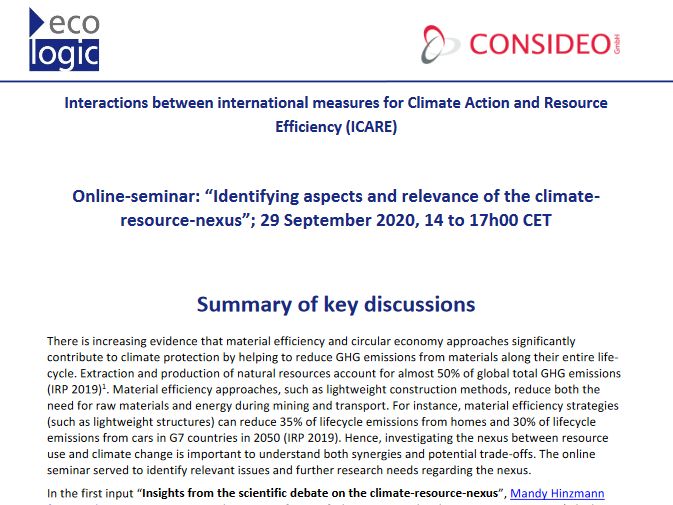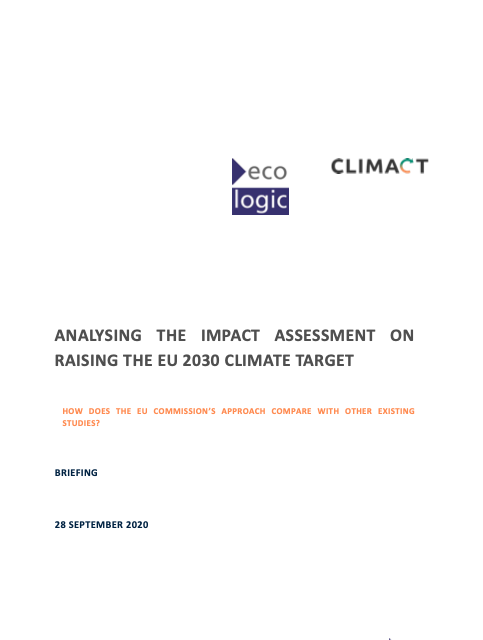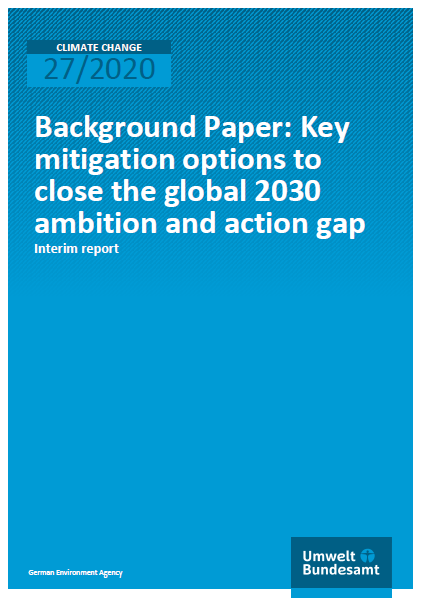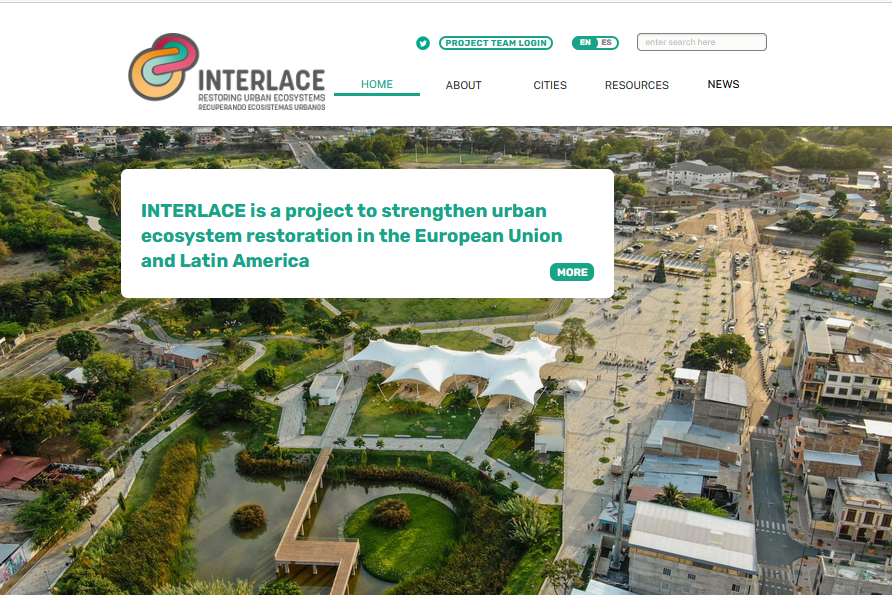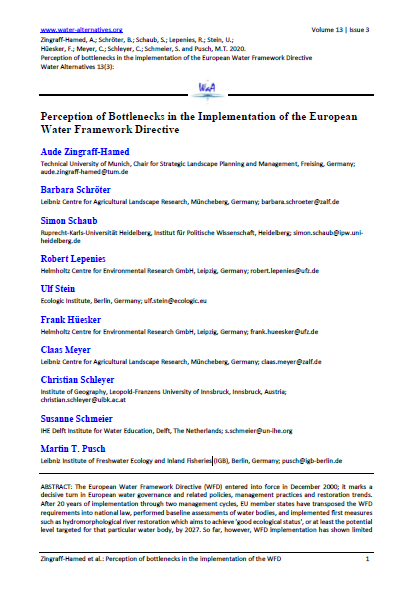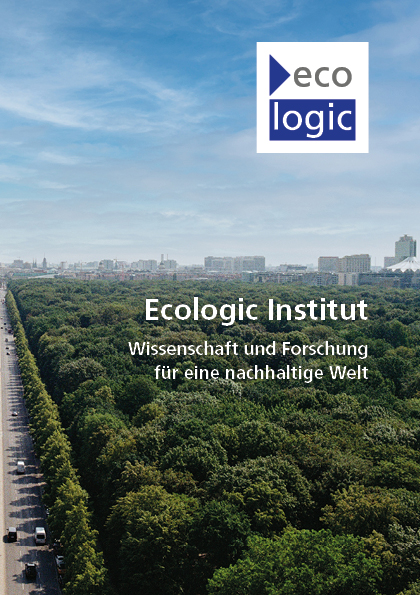Publikation:Bericht
Publikation:Bericht
Aligning the post-2020 CAP with the Green Deal
The European Green Deal, sustainable agri-food systems, and the Common Agricultural Policy
Jahr
WeiterlesenVeranstaltung:Digitale Veranstaltung
Publikation:Policy Brief
Analysing the Impact Assessment on Raising the EU 2030 Climate Target
How does the European Commission's approach compare with other existing studies?
Jahr
WeiterlesenVeranstaltung:Workshop
Publikation:Bericht
Veranstaltung:Konferenz
Veranstaltung:Konferenz
Publikation:Webseite
Publikation:Artikel
From State to User-based Water Allocations
An empirical analysis of institutions developed by agricultural user associations in France
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Broschüre
Publikation:Dokument
Veranstaltung:Visitors Program