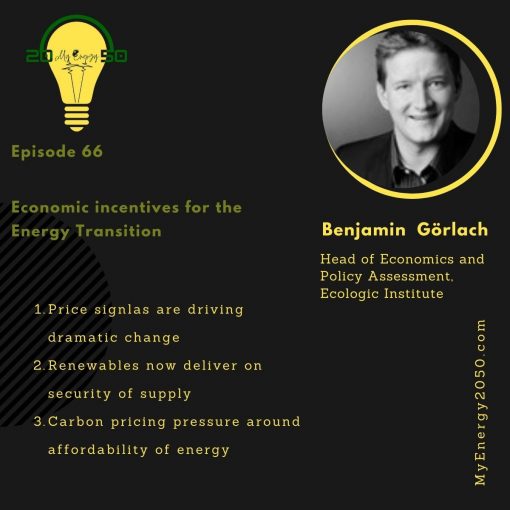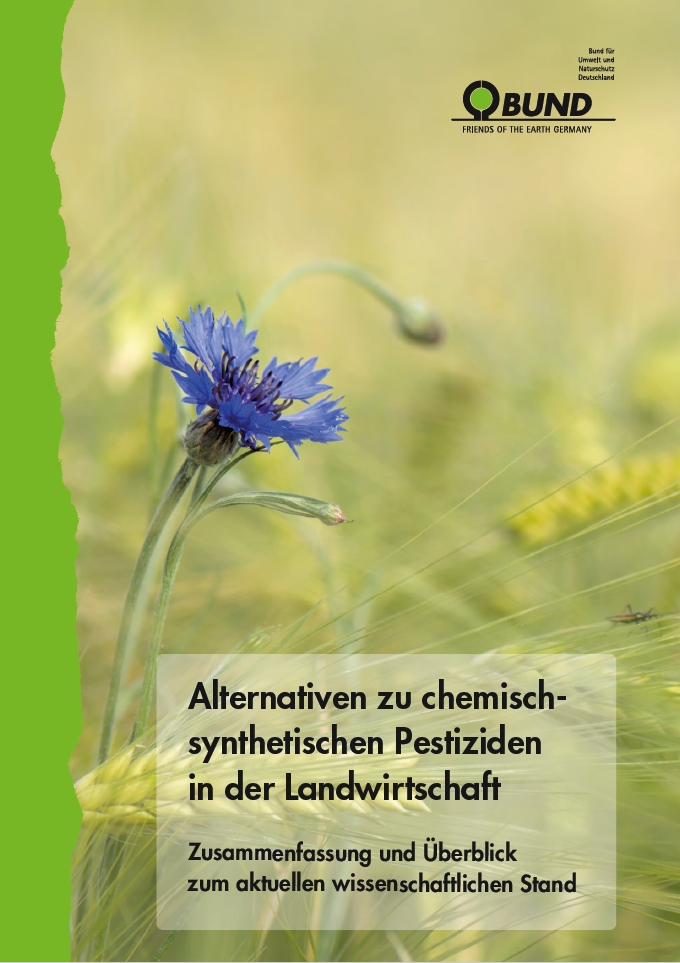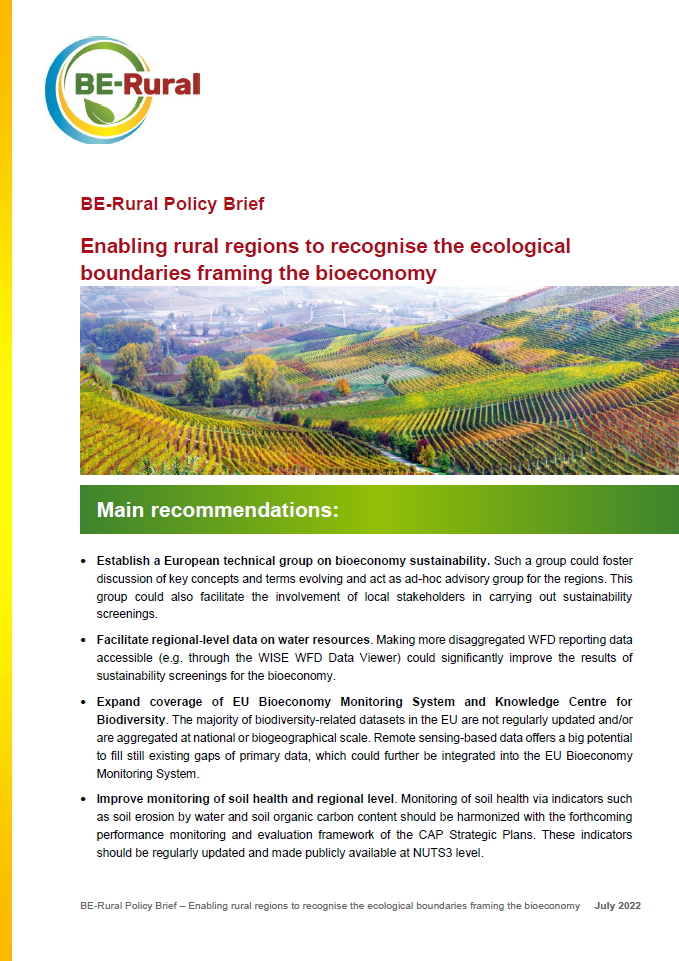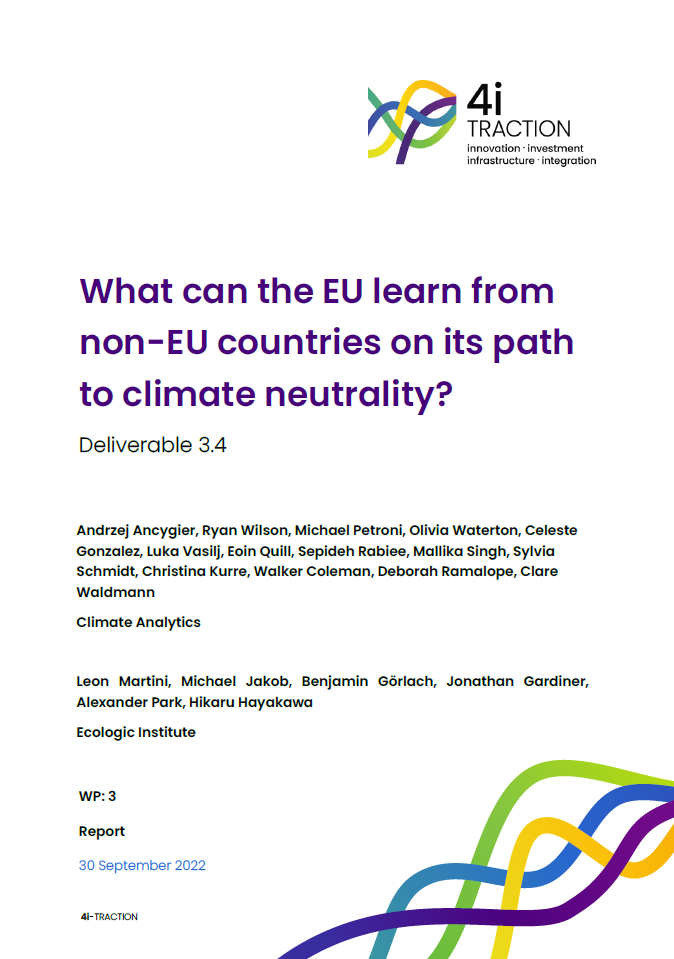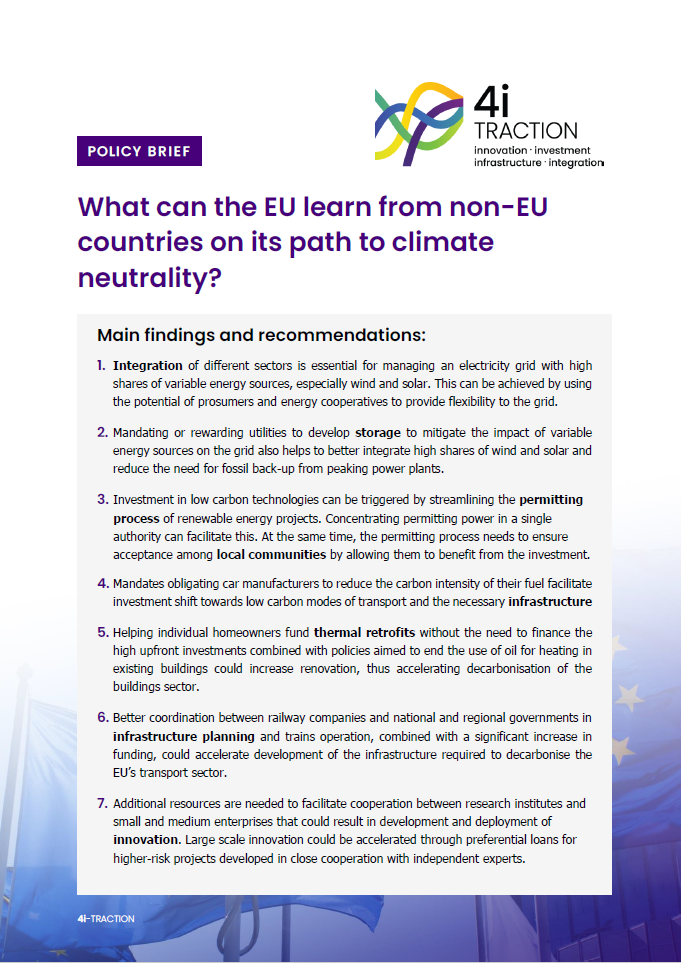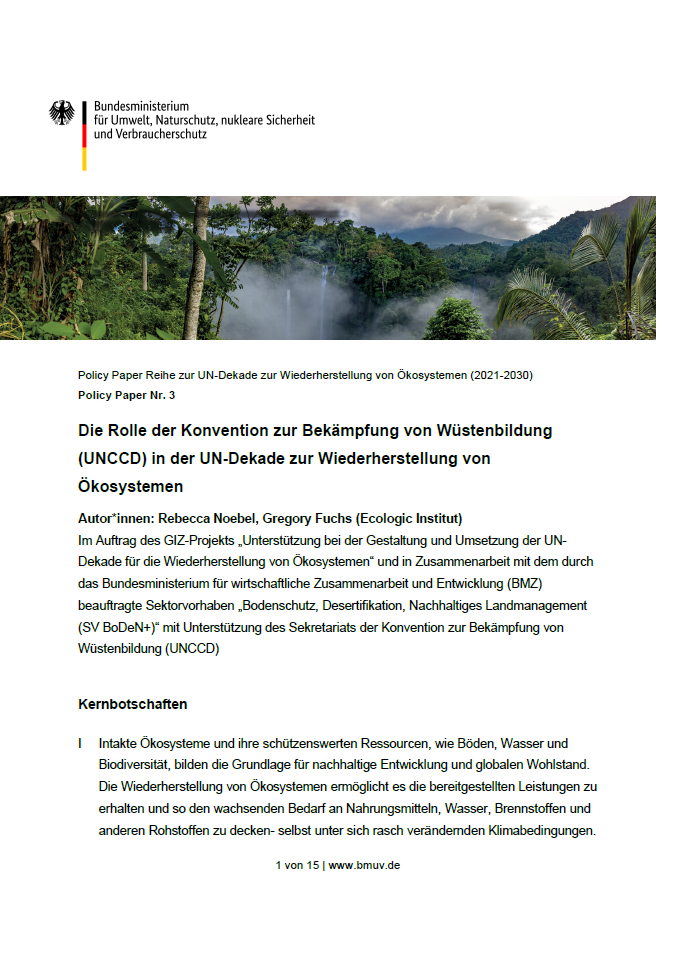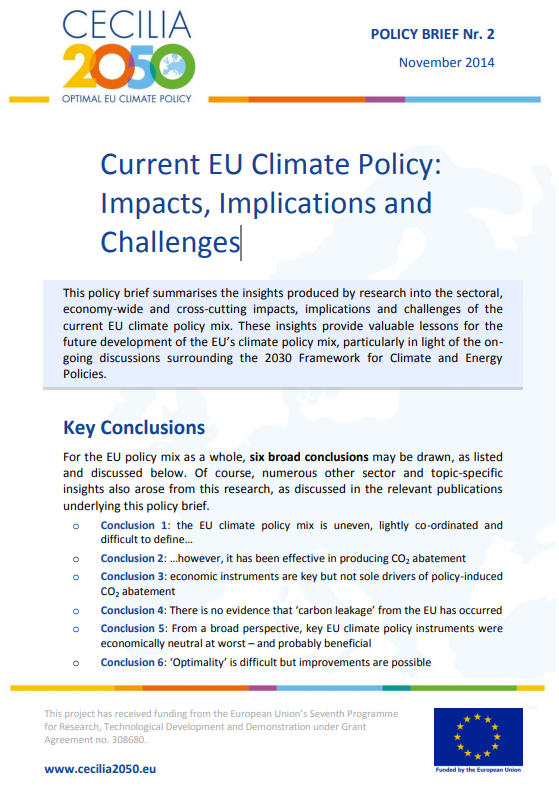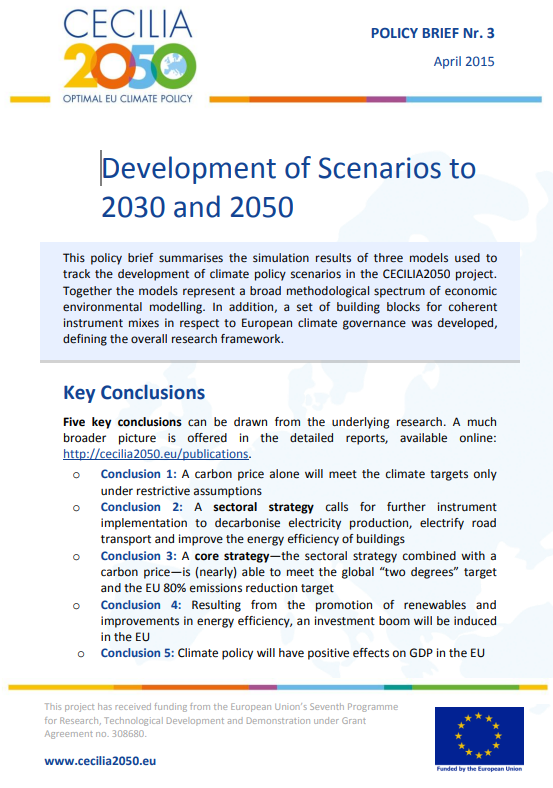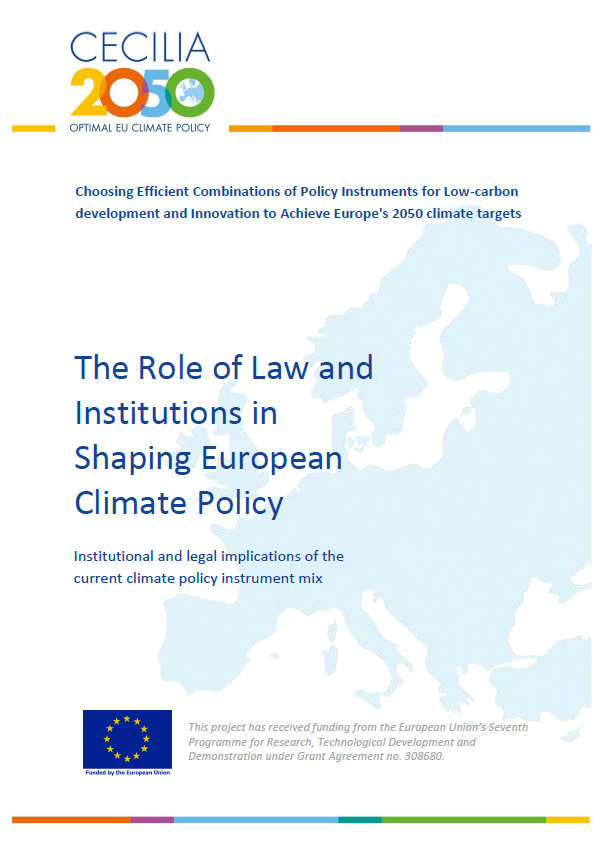Publikation:Dokument
Präsentation:Vortrag
Veranstaltung:Konferenz
Klimawandel, Kommunikation und Kultur
Resignation überwinden und gemeinsam die Zukunft gestalten
online
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Präsentation:Interview
Präsentation:Interview
Publikation:Bericht
Alternativen zu chemisch-synthetischen Pestiziden in der Landwirtschaft
Zusammenfassung und Überblick zum aktuellen wissenschaftlichen Stand
Jahr
WeiterlesenPublikation:Policy Brief
Publikation:Bericht
Publikation:Policy Brief
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Der EU-ETS-Preis bis 2030 und darüber hinaus
Ein Blick auf Treiber, Modelle und Annahmen
online
Publikation:Policy Brief
Publikation:Policy Brief
Current EU Climate Policy: Impacts, Implications and Challenges
CECILIA2050 Policy Brief No 2
Jahr
WeiterlesenPublikation:Policy Brief
Publikation:Bericht
The Role of Law and Institutions in Shaping European Climate Policy
Institutional and legal implications of the current climate policy instrument mix
Jahr
Weiterlesen