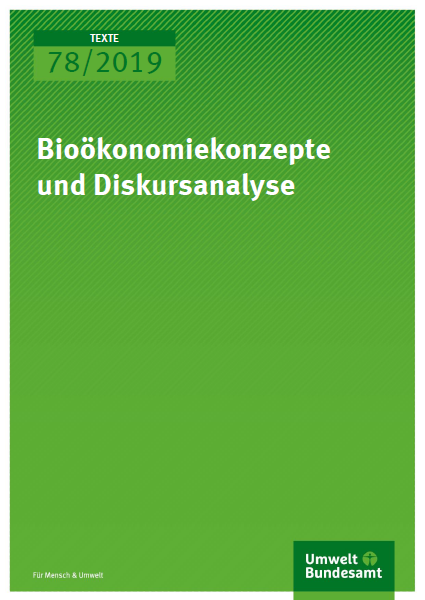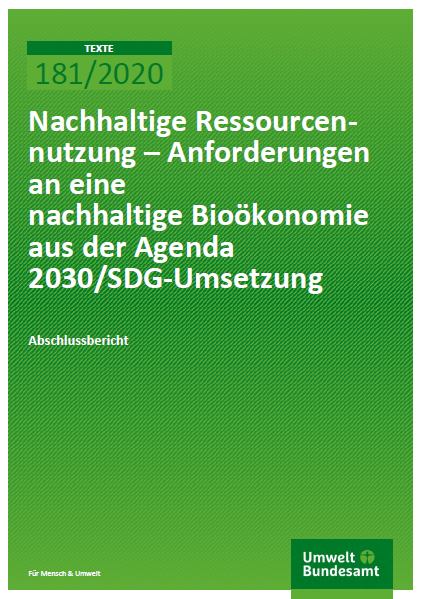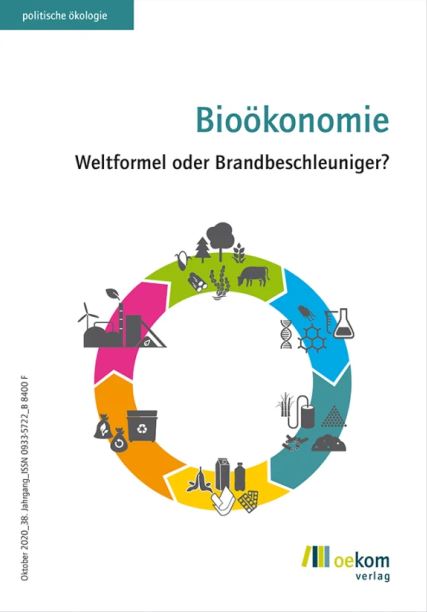Bioökonomiekonzepte und Diskursanalyse
- Publikation
- Zitiervorschlag
Kiresiewa, Zoritza et. al. 2019: Bioökonomiekonzepte und Diskursanalyse. Teilbericht (AP1) des Projekts "Nachhaltige Ressourcennutzung – Anforderungen an eine nachhaltige Bioökonomie aus der Agenda 2030/SDG-Umsetzung". Umweltbundesamt: Dessau-Roßlau.
Der hohe politische Stellenwert der Bioökonomie, als Weg um ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen, ist nicht zu übersehen — bis 2019 wurden weltweit über 50 dezidierte und Bioökonomie-unterstützende Politikstrategien veröffentlicht. Gleichzeitig ist das Konzept der Bioökonomie nicht unumstritten und birgt viele Zielkonflikte. Dieser Forschungsbericht untersucht, welche konkreten Ziele Bioökonomiepolitiken haben, welche Akteure dabei welche Interessen verfolgen, welche Positionen die unterschiedlichen Akteure einnehmen, welche Argumente für und gegen Bioökonomie-Strategien hervorgerbacht werden und welche ethischen Implikationen die Förderung der Bioökonomie haben kann.
Zoritza Kiresiewa und Marius Hasenheit vom Ecologic Institut analysieren in diesem Forschungsbericht Bioökonomie-Strategien und -Akteure. Die Analyse zeigte, dass die in den Strategiepapieren präsentierten "Bioökonomie-Visionen" in der Regel nur grob definiert sind. Dabei überwiegt die Vision von einer neuen Wirtschaftsform, die statt fossilen Ressourcen Biomasse als Rohstoff für die Produktion von Kraftstoffen, Elektrizität, Chemikalien, Kunststoffen und Textilien nutzt. Aufgeführt werden in den Strategiepapieren auch verschiedene Umweltbelange, wie die Substitution fossiler Ressourcen durch biologische, Naturschutz und eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Hervorgehoben werden diese jedoch in der Regel nicht.
Generell lässt sich feststellen, dass die Bioökonomie durch eine stark fragmentierte Akteurslandschaft geprägt ist. Die verschiedenen Akteursgruppen favorisieren dabei in der Regel den jeweiligen Entwicklungspfad, der ihren Interessen am ehesten entspricht. Dementsprechend ergeben sich Zielkonflikte – etwa Nutzungskonkurrenzen um Land und Biomasse ("Teller vs. Tank"), steigende Biomassennachfrage (Ausweitung & Intensivierung landwirtschaftlicher Nutzung) sowie Biomasse-Nutzung durch Biotechnologieanwendungen welche auf Naturschutzansprüche treffen. Diese Zielkonflikte werden in den Strategiepapieren mit unterschiedlicher Gewichtung adressiert, jedoch kaum gelöst.
Die Analyse des aktuellen Bioökonomie-Diskurses in Deutschland, die vom Öko-Institut durchgeführt wurde, weist eine starke Polarisierung auf und kann in drei (nicht trennscharf abgrenzbare) Teildiskurse unterteilt werden:
- einen affirmativen Bioökonomie -Diskurs, der Chancen der Bioökonomie betont;
- einen pragmatischen Bioökonomie -Diskurs, der Chancen und Risiken der Bioökonomie gegeneinander abwägt und nach stringenten Nachhaltigkeitsstandards ruft;
- einen kritischen Bioökonomie -Diskurs, der mit dem aktuell genutzten Konzept der Bioökonomie mehr ökologische und soziale Risiken als Chancen verbindet und einen grundsätzlicheren Wandel fordert.
Der Bericht steht zum Download bereit.