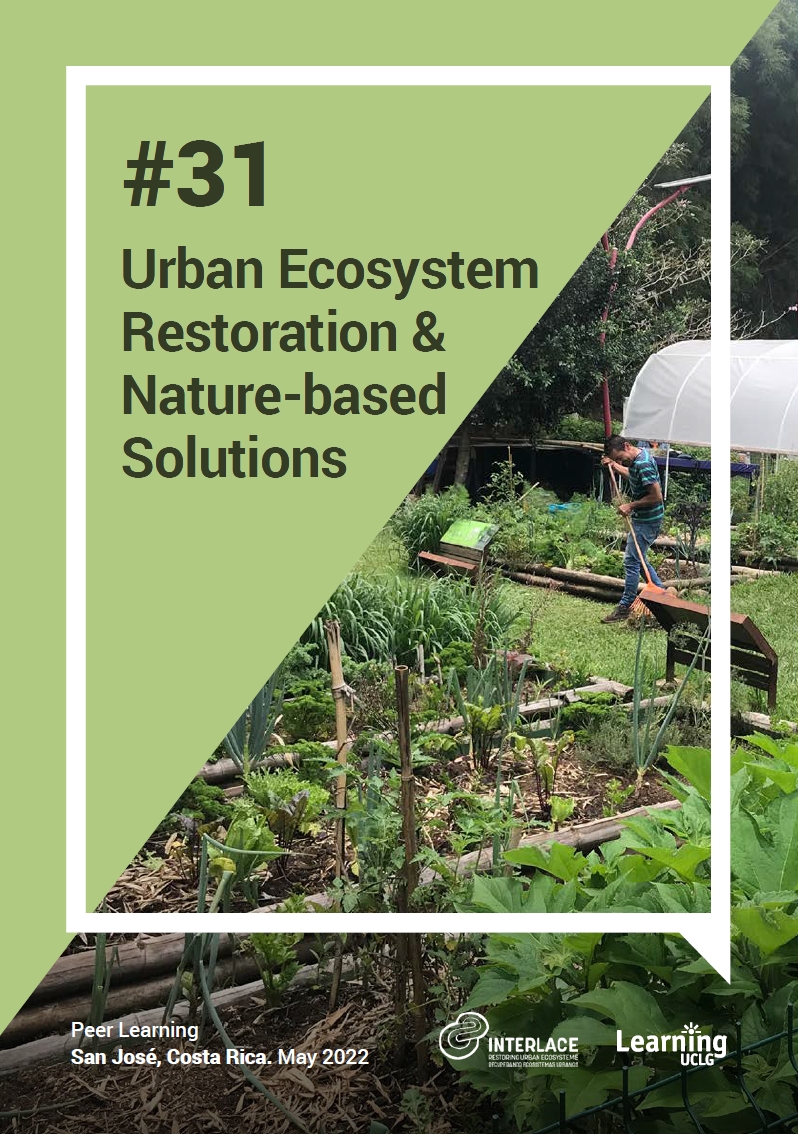Bild von SimoneVomFeld auf Pixabay
Wie können Naturschutzmaßnahmen so gestaltet werden, dass sie Ökosysteme widerstandsfähiger gegen den Klimawandel machen? Dieser Frage widmet sich ein vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördertes Forschungsprojekt unter der Leitung des Ecologic Instituts. Ziel ist es, ein wissenschaftlich fundiertes und zugleich praxisorientiertes Konzept zur Bewertung und Förderung der Klimaresilienz von Ökosystemen in Deutschland zu entwickeln. Die Ergebnisse sollen strategische Impulse für eine klimaresiliente Ausrichtung des Naturschutzes geben.
Warum Klimaresilienz im Naturschutz entscheidend ist
Klimawandelbedingte Extremereignisse wie Dürren, Starkregen oder Hitzeperioden bringen viele Ökosysteme an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Die Folge: schwindende Artenvielfalt, gestörte Stoffkreisläufe und der Verlust wertvoller Ökosystemleistungen – von Bodenfruchtbarkeit bis Wasserregulierung. Resiliente Ökosysteme können solchen Belastungen besser standhalten, sich schneller erholen oder an veränderte Bedingungen anpassen. Doch bisher fehlt es an konkreten Konzepten, um Klimaresilienz systematisch in Planungsprozesse des Naturschutzes zu integrieren.
Ziel: Ein praxisnahes Konzept für klimaresiliente Ökosysteme
Im Zentrum des Projekts steht die Entwicklung eines Bewertungs- und Handlungskonzepts, das es ermöglicht, Resilienzmerkmale in verschiedenen Ökosystemtypen zu identifizieren, zu bewerten und gezielt zu stärken. Das Konzept soll sowohl wissenschaftlich belastbar als auch in der naturschutzfachlichen Praxis anwendbar sein – etwa bei der Auswahl und Gestaltung von Schutzmaßnahmen oder in der Flächenplanung.
Ecologic Institut: Wissenschaftliche Leitung, Praxisbezug und Wirkung
Das Ecologic Institut leitet das Projektkonsortium und verantwortet die konzeptionelle und methodische Entwicklung des Resilienzansatzes, die Analyse resilienzfördernder Eigenschaften in verschiedenen Ökosystemen sowie die Ableitung praxisorientierter Handlungsempfehlungen. Gemeinsam mit einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe (PAG) wird sichergestellt, dass Perspektiven aus Verwaltung, Planung und Wissenschaft in die Konzeptentwicklung einfließen. Die Ergebnisse des Projekts werden in Workshops, Leitfäden und einer internationalen Fachpublikation aufbereitet. Damit unterstützt das Projekt Akteur:innen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene dabei, Naturschutzstrategien klimaresilient weiterzuentwickeln und vorhandene Instrumente zukunftsfähig auszurichten.