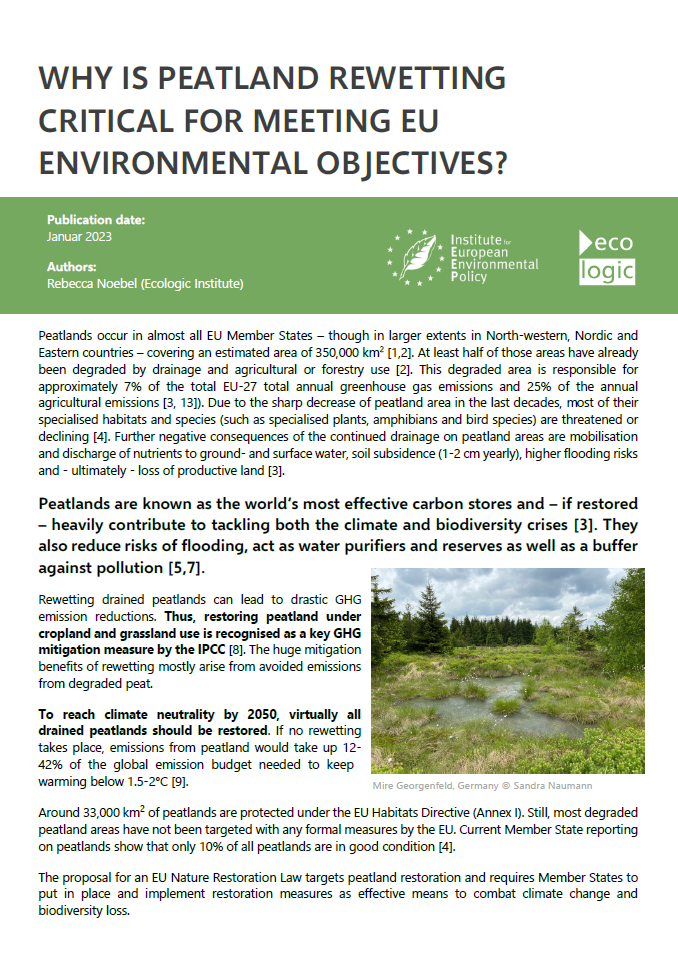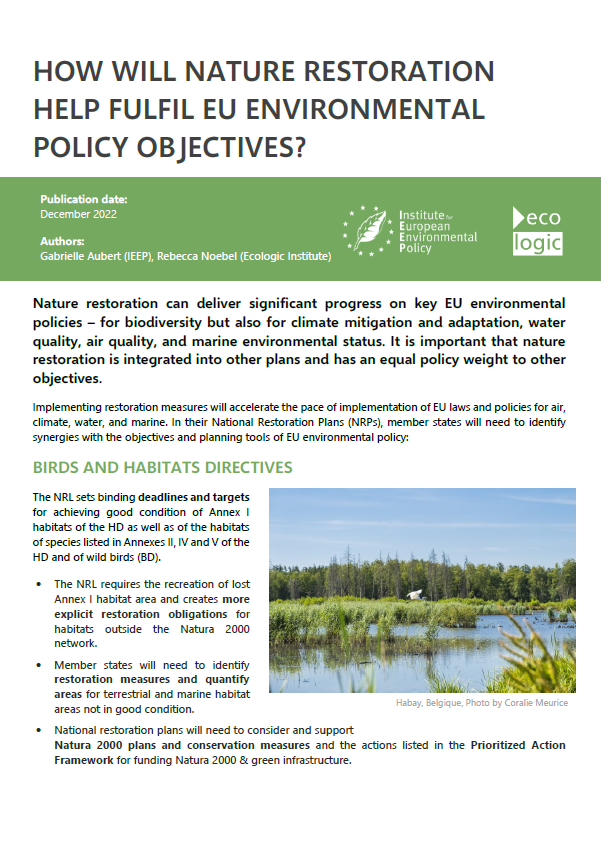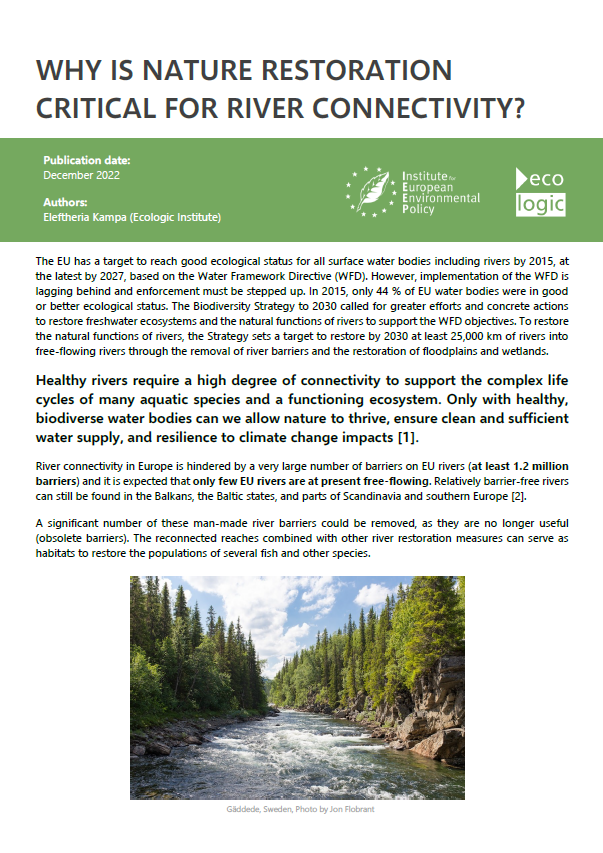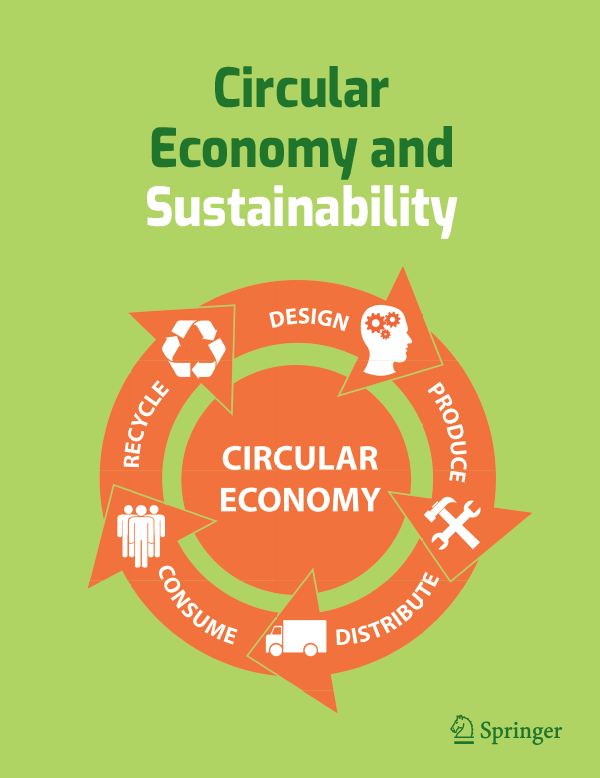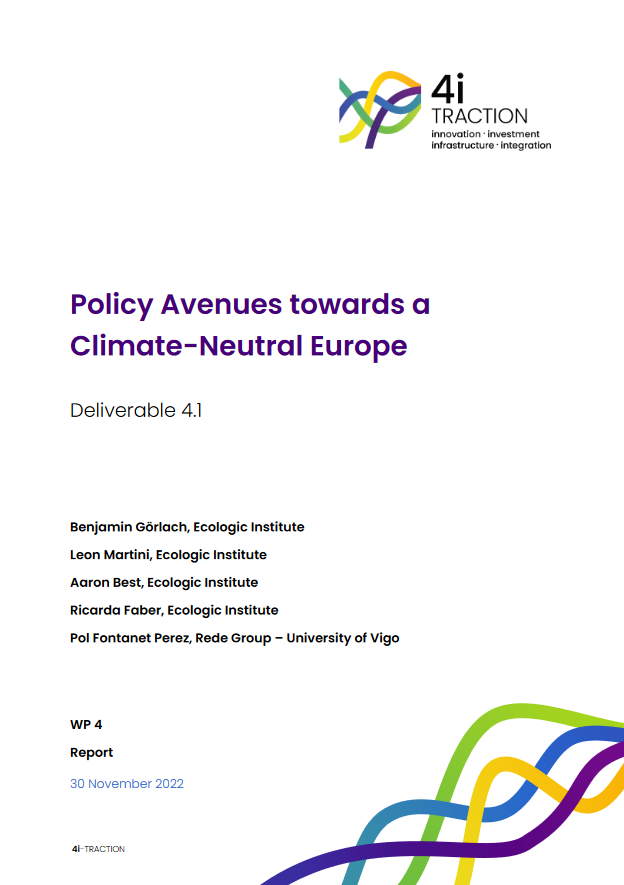Publikation:Policy Brief
Publikation:Policy Brief
Publikation:Policy Brief
Publikation:Policy Brief
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Finanzierung einer klimafreundlichen Bodennutzung in der EU
Herausforderungen und Risiken marktorientierter Ansätze
online
Projekt:Horizont Europa
Projekt:Horizont Europa
Publikation:Artikel
Publikation:Podcast
Fifty Shades of Green: Nachhaltige Finanzen und die EU-Taxonomie
Siebte Folge des Podcasts "Green Deal – Big Deal?"
Jahr
WeiterlesenPublikation:Buch
Publikation:Poster
Publikation:Postkarte
Projekt
Publikation:Bericht