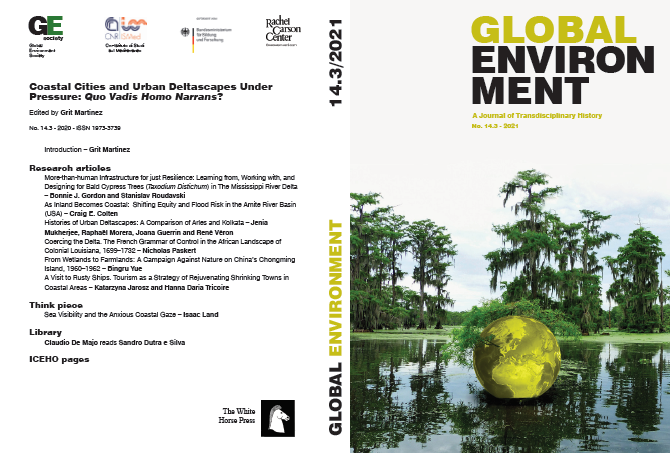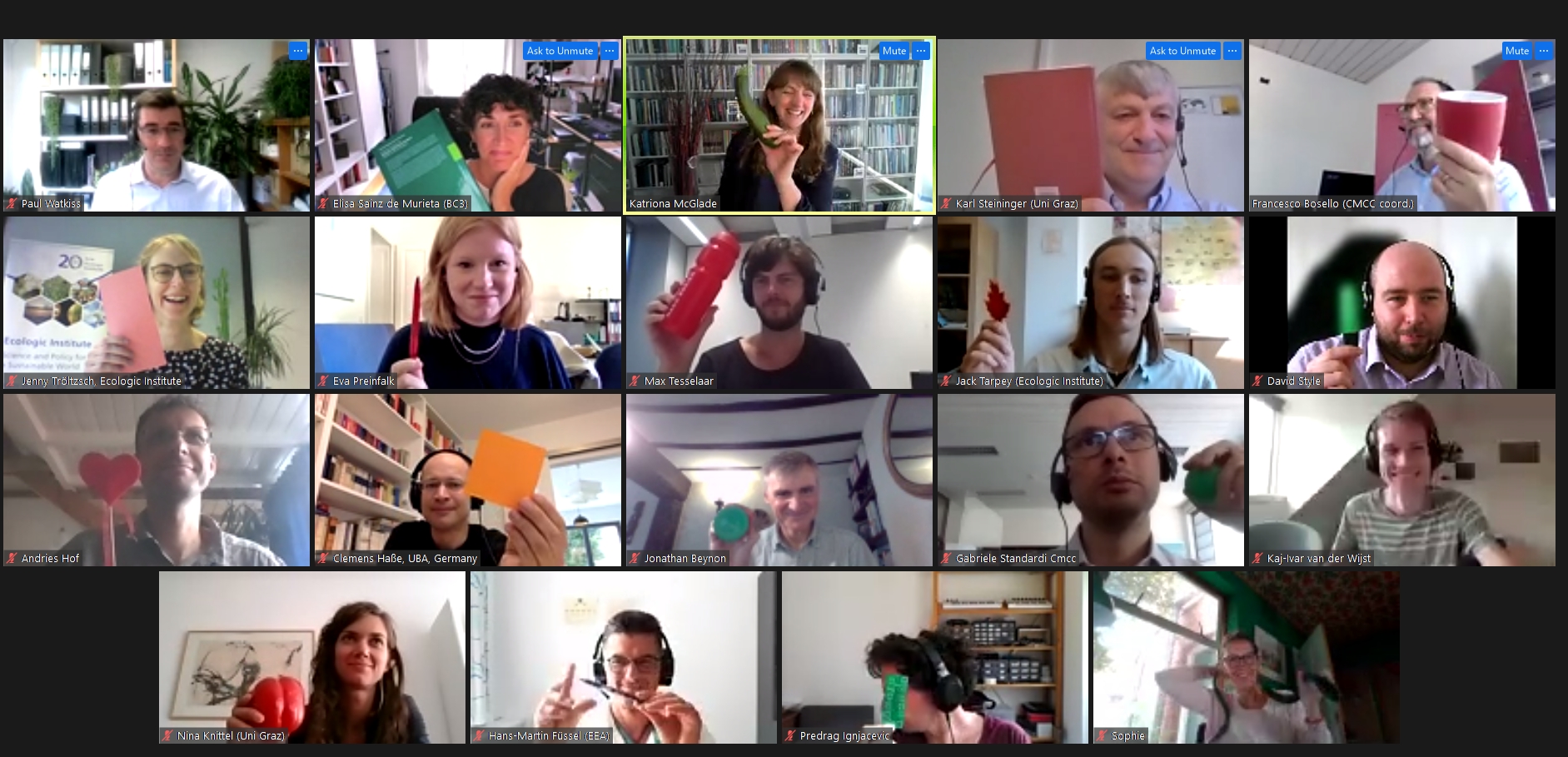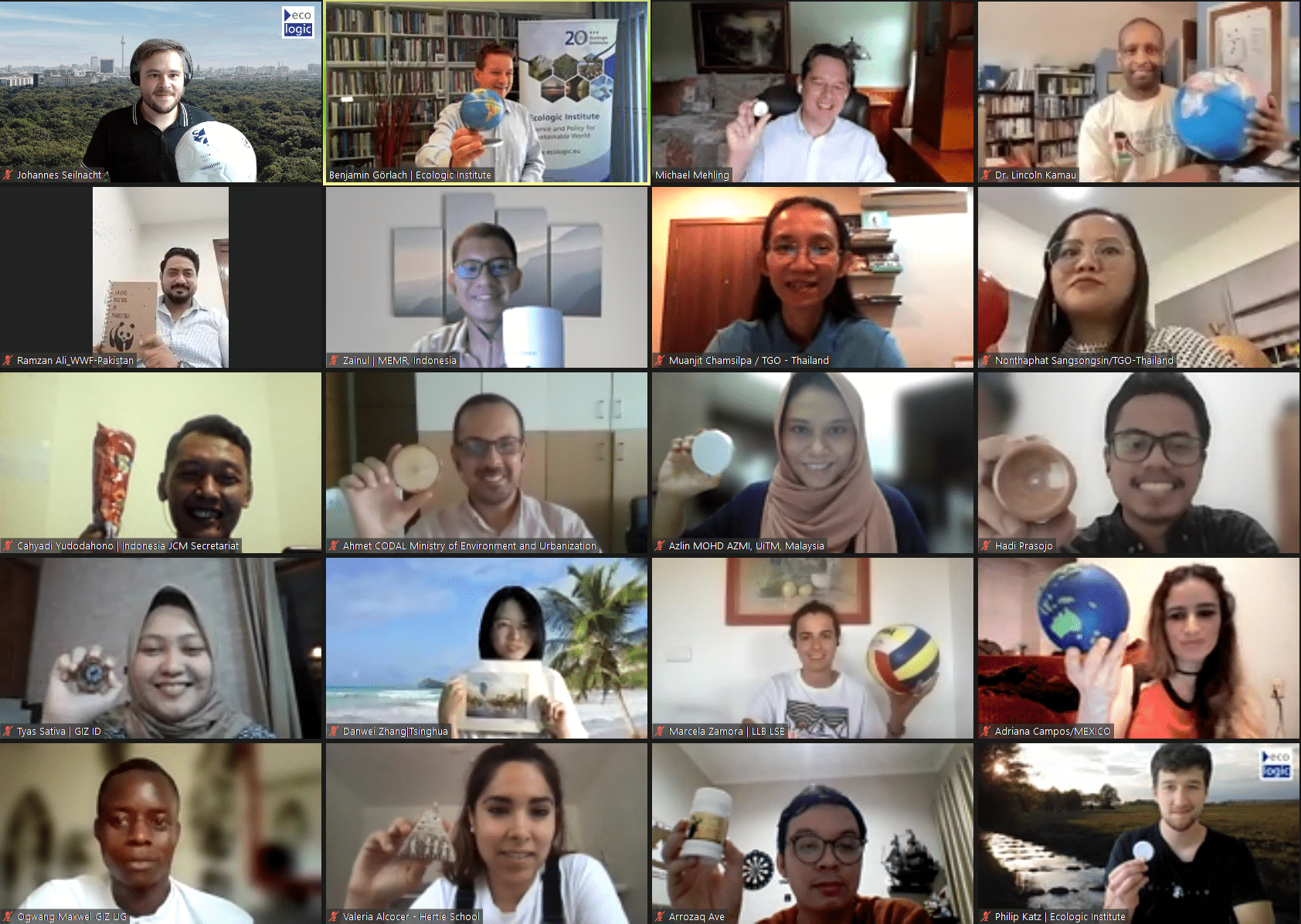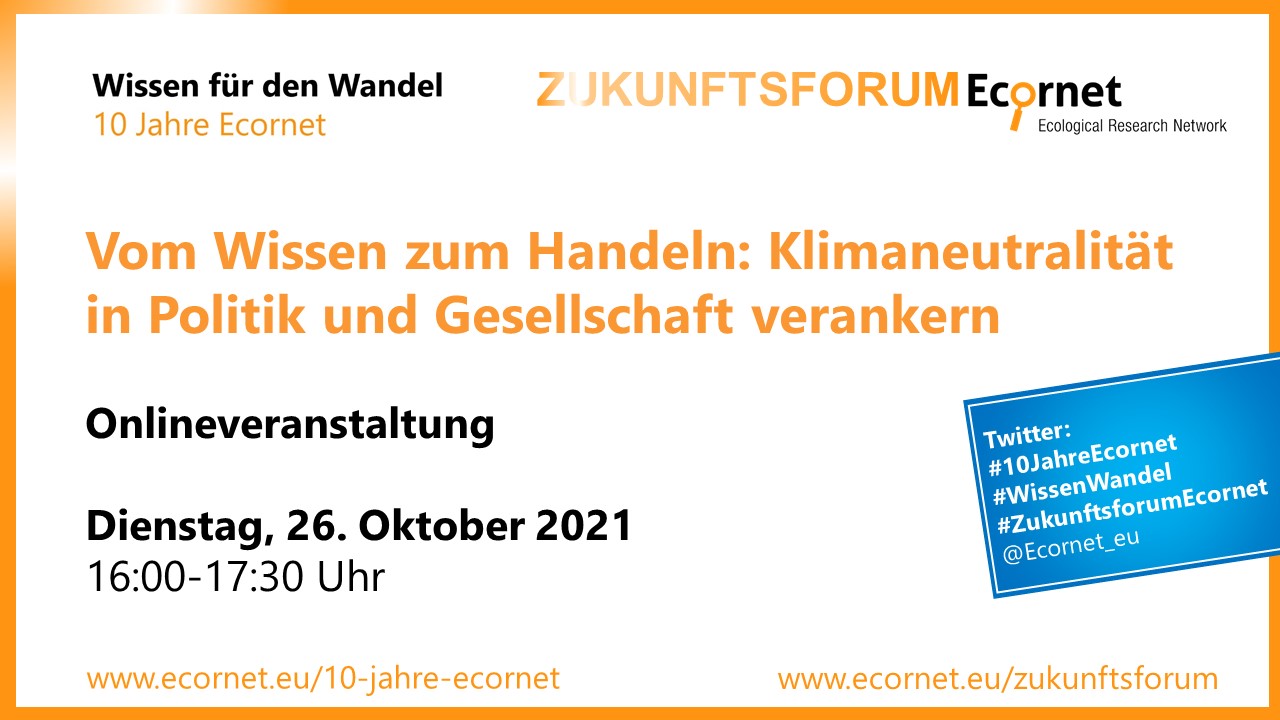Publikation:Artikel
Veranstaltung:Workshop
Politikanalysen für Anpassungsoptionen und COACCH Co-design Aktivitäten
4. Interaktiver Co-Design-Workshop
-
online
Präsentation:Podiumsdiskussion
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel
News
50 Jahre Umweltprogramm
1971 legt das erste Umweltprogramm der Bundesrepublik den Grundstein für eine Umweltpolitik
Weiterlesen
Projekt
Veranstaltung:Summer School
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Die Transformation zur Kreislaufwirtschaft zwischen Ambitionen und Realitäten
Das Beispiel Textil
online
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Veranstaltung:Digitale Veranstaltung
Publikation:Artikel
Fleischalternativen: Vegetarischer und veganer Fleischersatz wächst
Beitrag zum "Fleischatlas" 2021: Die Rolle von Fleischersatzprodukten
Jahr
Weiterlesen