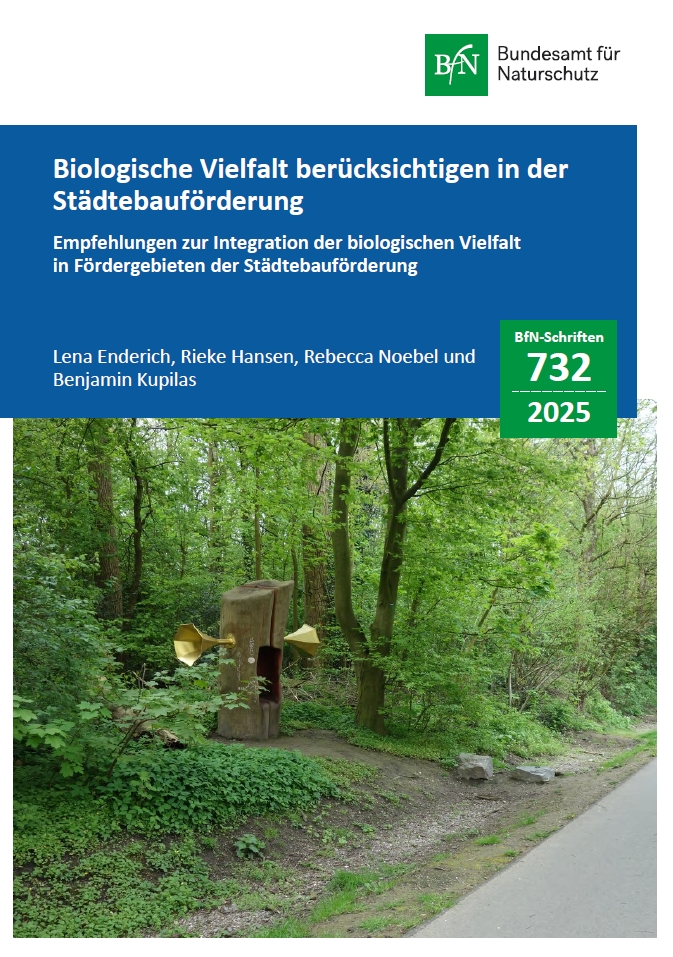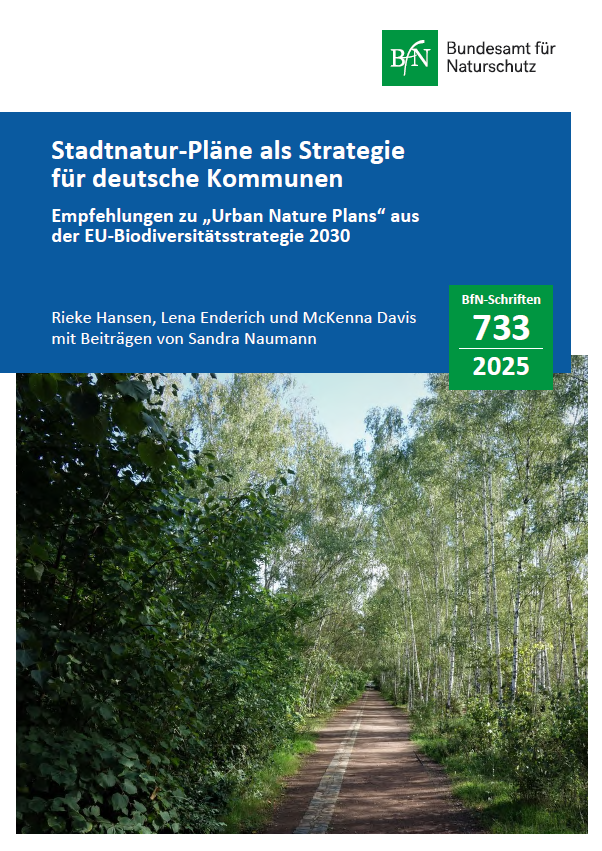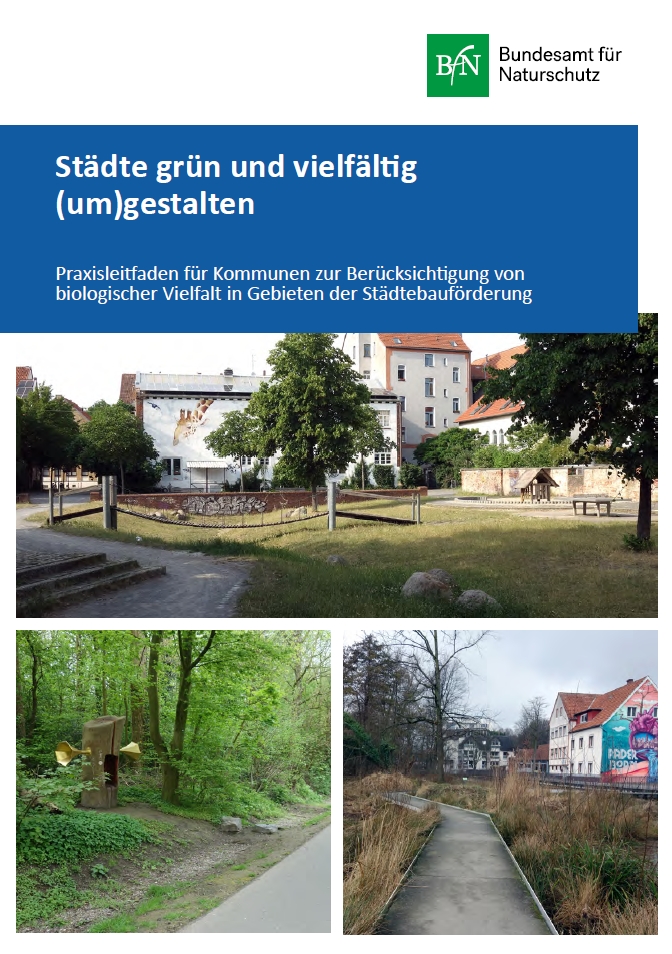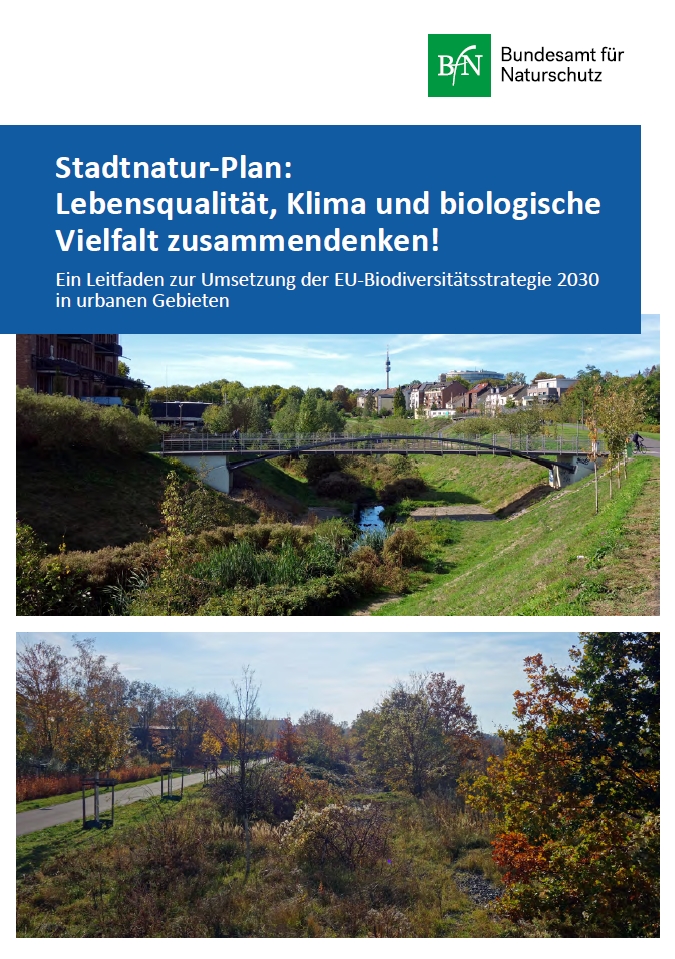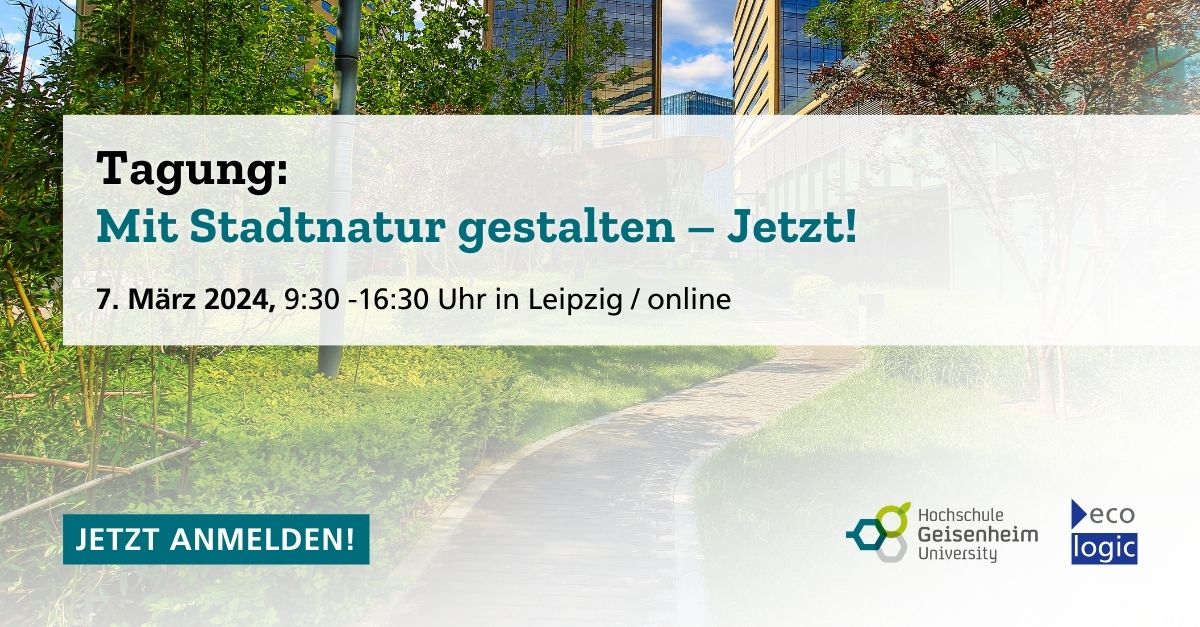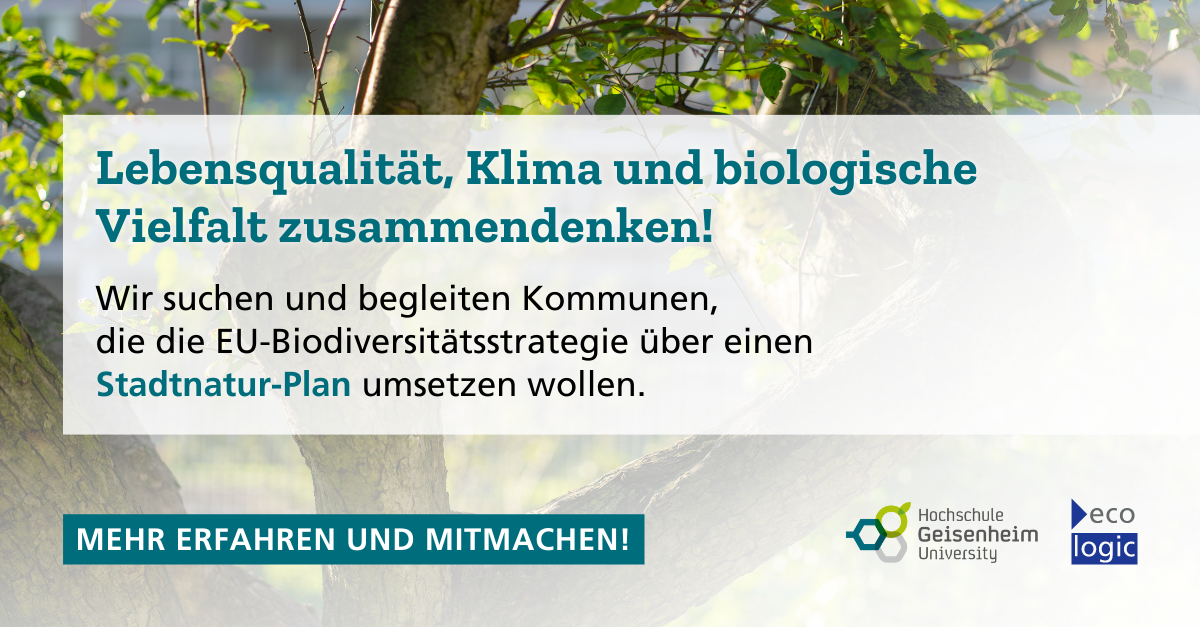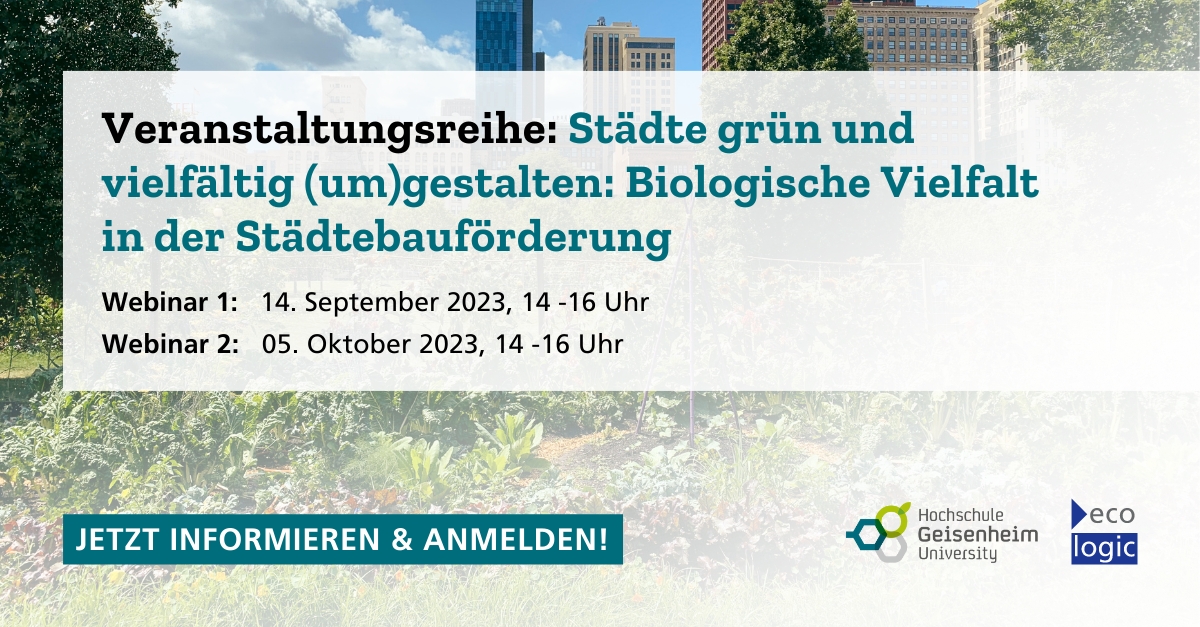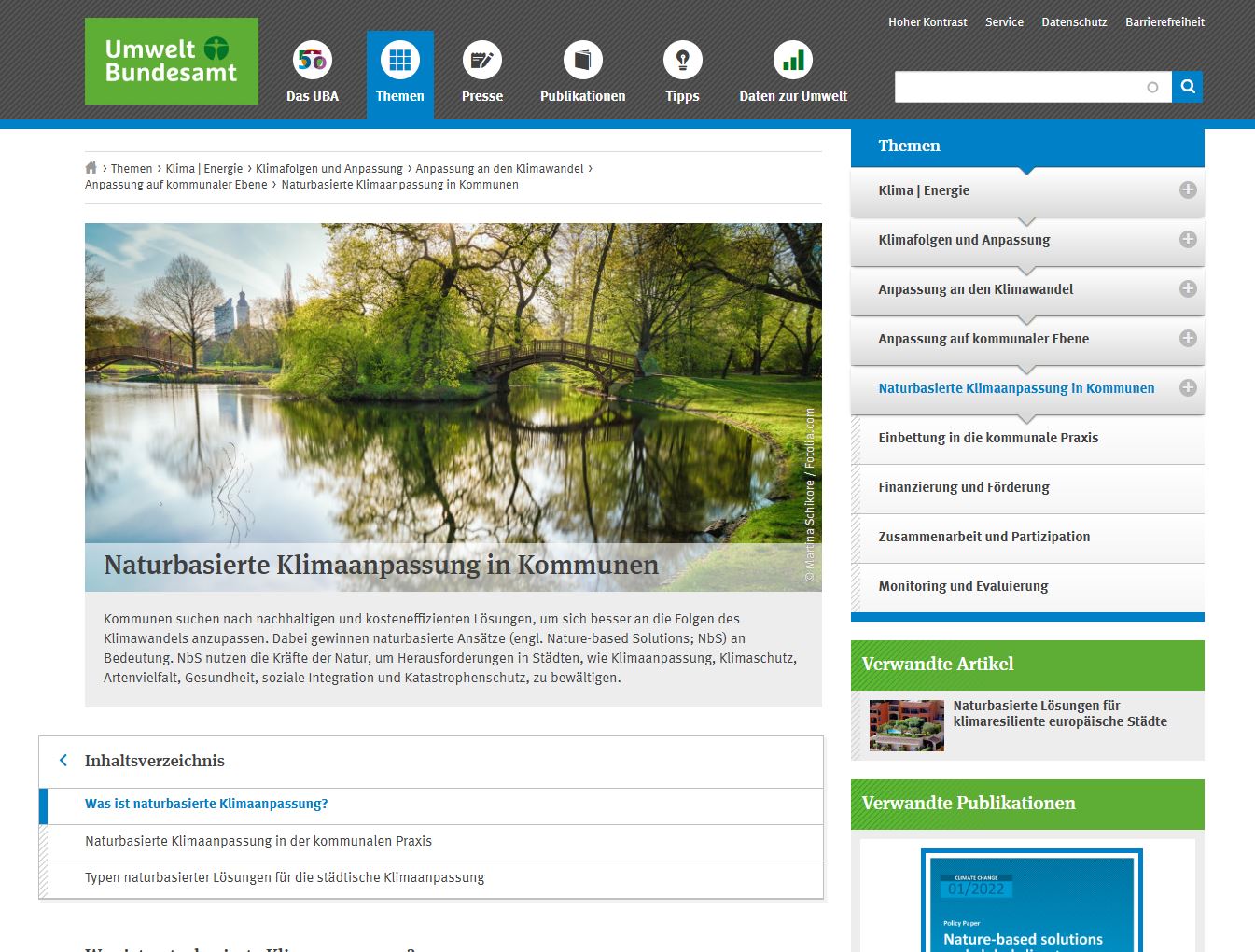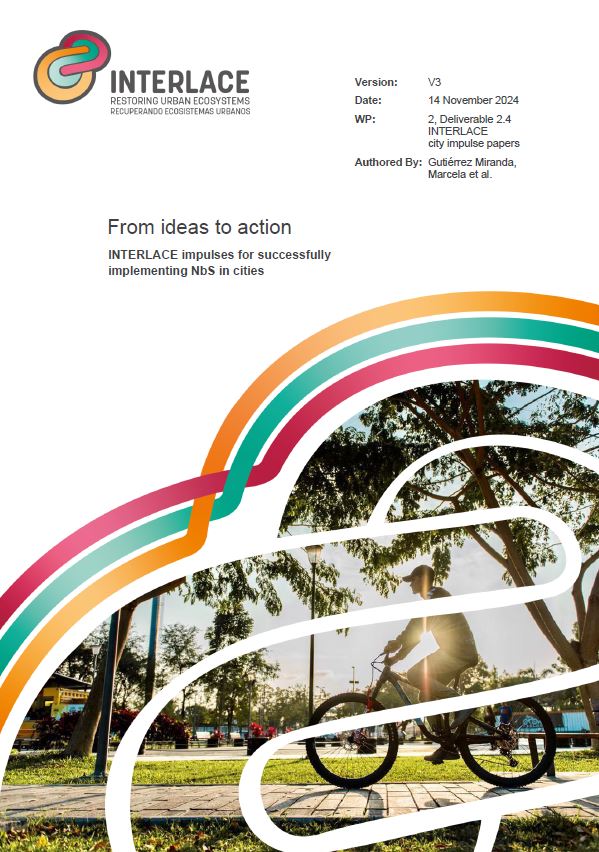Biologische Vielfalt berücksichtigen in der Städtebauförderung
Empfehlungen zur Integration der biologischen Vielfalt in Fördergebieten der Städtebauförderung
- Publikation
- Zitiervorschlag
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2025): Biologische Vielfalt berücksichtigen in der Städtebauförderung. Empfehlungen zur Integration der biologischen Vielfalt in Fördergebieten der Städtebauförderung. Bonn.
Im Fokus dieser Publikation steht die Frage, wie Kommunen Fördermittel der Städtebauförderung gezielt für die Erhaltung und Förderung urbaner Biodiversität einsetzen können. Das Ecologic Institut war im Forschungsprojekt "BioViBeS – Biologische Vielfalt berücksichtigen in der Städtebauförderung" als Kooperationspartner des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) maßgeblich an der Analyse von Best-Practice-Beispielen und der Ableitung praxisorientierter Handlungsfelderund Empfehlungen beteiligt.
Biologische Vielfalt als Schlüssel für nachhaltige Stadtentwicklung
Die integrierte Stadtentwicklung bietet einen idealen Rahmen, um Stadtgrün, Klimaanpassung und Biodiversität miteinander zu verzahnen. Studien zeigen, dass urbane Lebensräume aufgrund ihrer Strukturvielfalt oft artenreicher sind als ihr Umland, jedoch gleichzeitig besonderer Pflege und Vernetzung bedürfen. Nur über ein ganzheitliches Verständnis von "Stadtnatur" – das von Parks über Dachbegrünungen bis zu Kleinstlebensräumen reicht – lässt sich deren Resilienz gegenüber Klimastress und Zerschneidung sichern.
Drei Handlungsfelder für die Praxis
Aus der Analyse von 52 integrierten Stadtentwicklungskonzepten, Expert:innen-Interviews und Literatur wurden drei zentrale Handlungsfelder identifiziert:
- Stadtgrünmaßnahmen: Neuanlage von Grünflächen (z. B. Parks, Trittsteinbiotope), Aufwertung und Vernetzung bestehender Flächen (etwa extensivere Pflege, Entsiegelung), Vernetzung von Freiräumen (Grünzüge, Korridore) und Wiederherstellung naturnaher Strukturen.
- Maßnahmen an Gebäuden: Dach- und Fassadenbegrünung sowie Nisthilfen ("Siedlungsarten fördern") zur Schaffung zusätzlicher Habitate direkt am Bauwerk.
- Planung & Prozesse: Entwicklung verbindlicher Konzepte (z. B. Biodiversitätsleitlinien), verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit (Grünflächen-, Stadtplanungs- und Umweltämter), frühzeitige Bürger:innen-Beteiligung und Kommunikation, um Akzeptanz und Engagement vor Ort zu fördern.
Synergien mit Klimaschutz und Lebensqualität nutzen
Die neuen Fördervoraussetzungen seit 2020 schreiben Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel explizit vor – und benennen dabei auch die "Erhöhung der Biodiversität" als förderfähige Maßnahme. Kommunen profitieren davon, biologische Vielfalt nicht als isoliertes Thema zu sehen, sondern als integralen Bestandteil klimagerechter Grüninfrastruktur. So können etwa Schwammstadt- und nature-based-solutions-Ansätze Regenwasser managen und gleichzeitig Lebensräume bereithalten; gleichzeitig steigern urbanes Grün und schattenspendende Bäume die Lebensqualität in dicht bebauten Quartieren.
Empfehlungen für Bund und Länder
Zur Verstetigung des Impulses durch das Programm "Zukunft Stadtgrün" sollten Bund und Länder in ihren Förderrichtlinien Biodiversitätsziele klar verankern und Best Practices in Handreichungen beschreiben. Die Autor:innen empfehlen insbesondere:
- Fördervoraussetzungen konkretisieren: Biodiversitätskriterien in die Programmtexte aufnehmen.
- Rahmeninformationen bereitstellen: Einheitliches Vokabular und praxisnahe Leitfäden für Kommunen entwickeln.
- Pflege und Monitoring sichern: Längere Förderzeiträume für Pflegekonzepte und Evaluierungen etablieren.
- Kompetenzen stärken: Schulungen für Fachpersonal und interkommunale Netzwerke (z. B. "Kommunen für biologische Vielfalt") fördern.