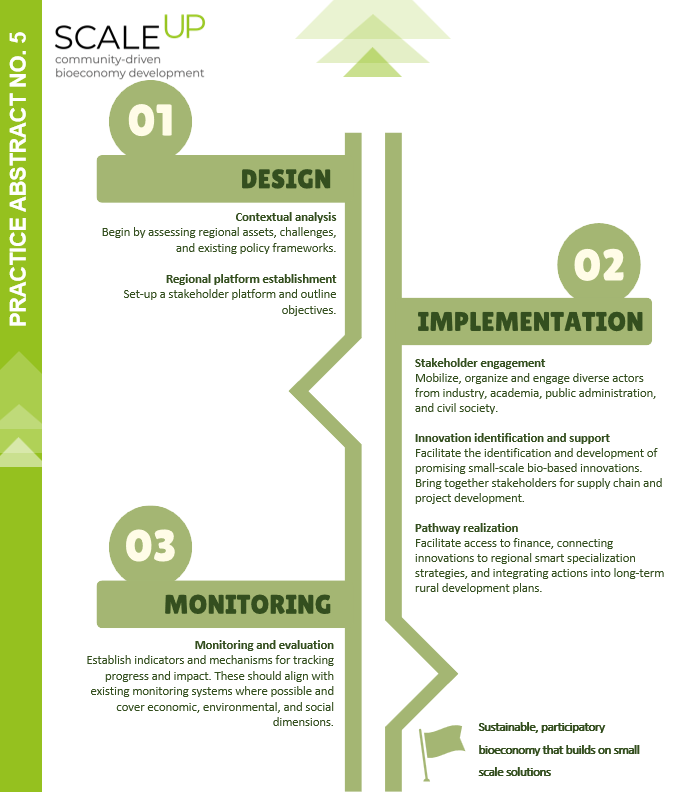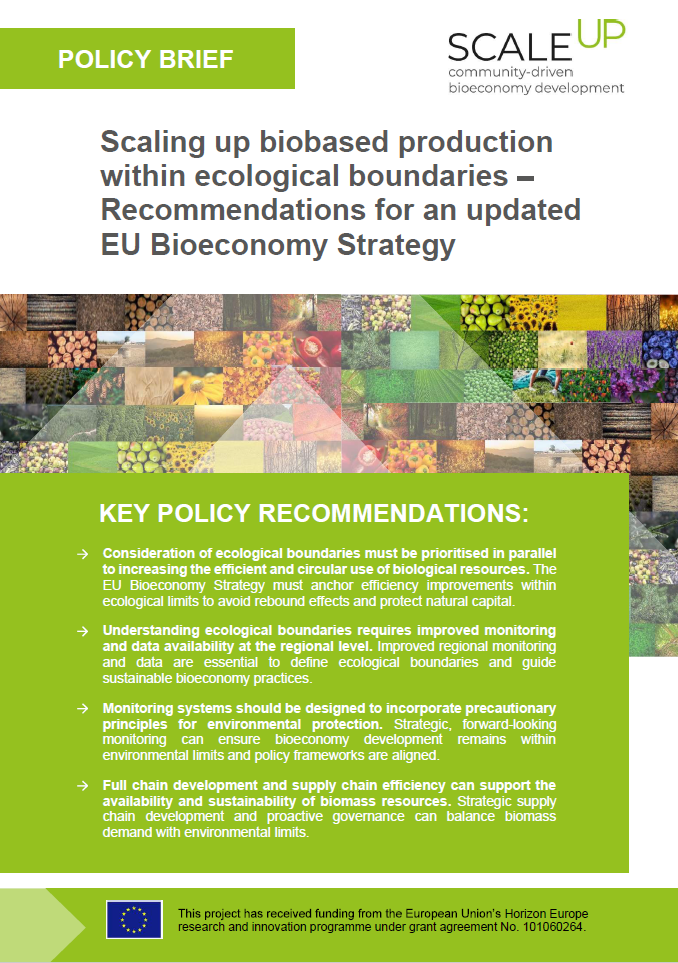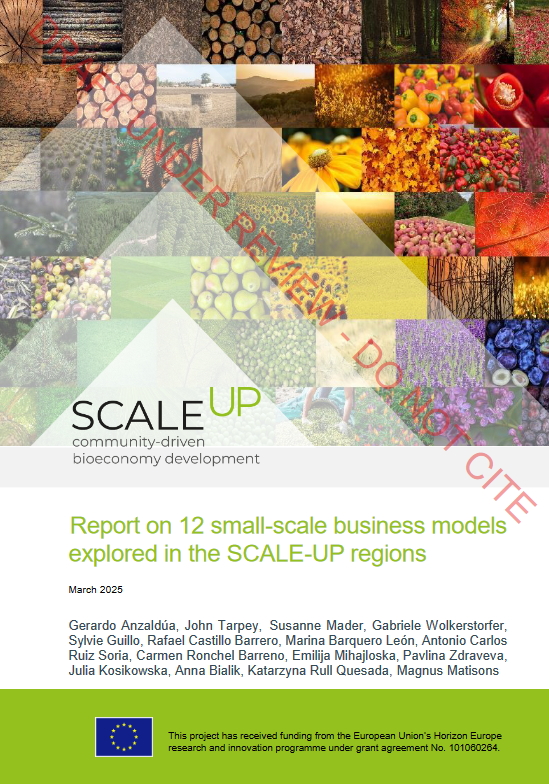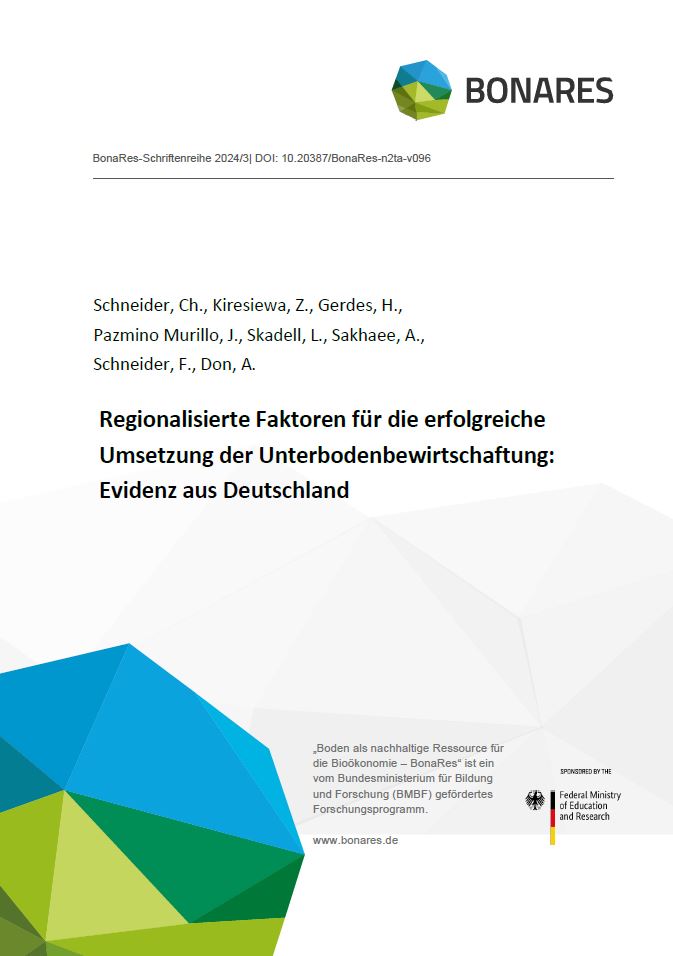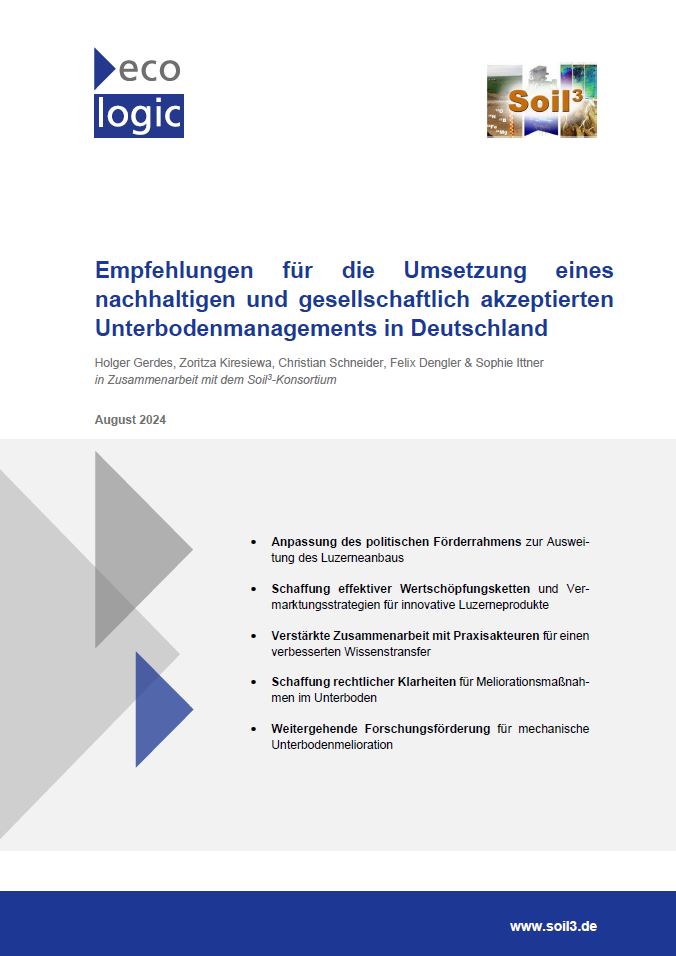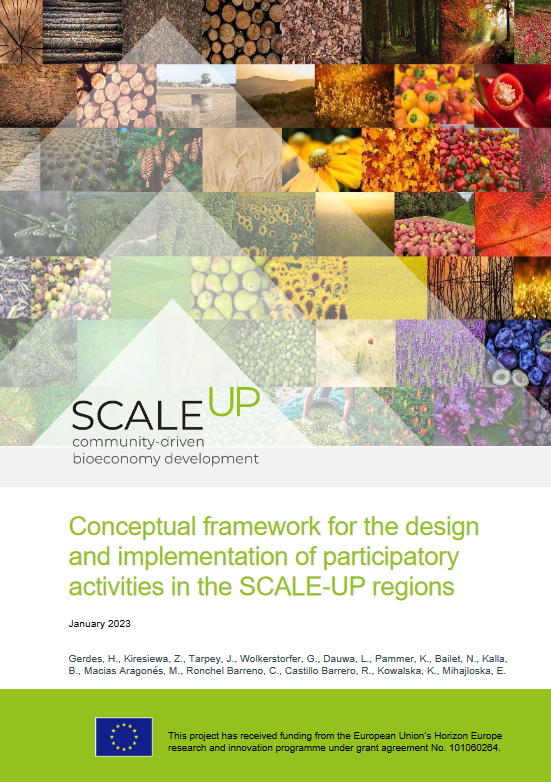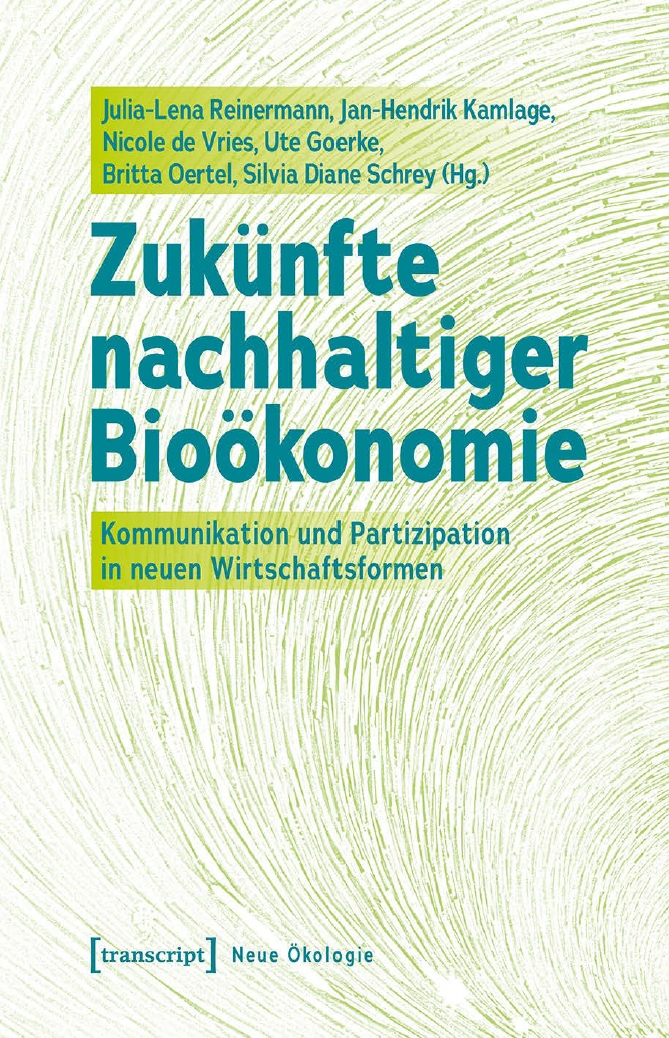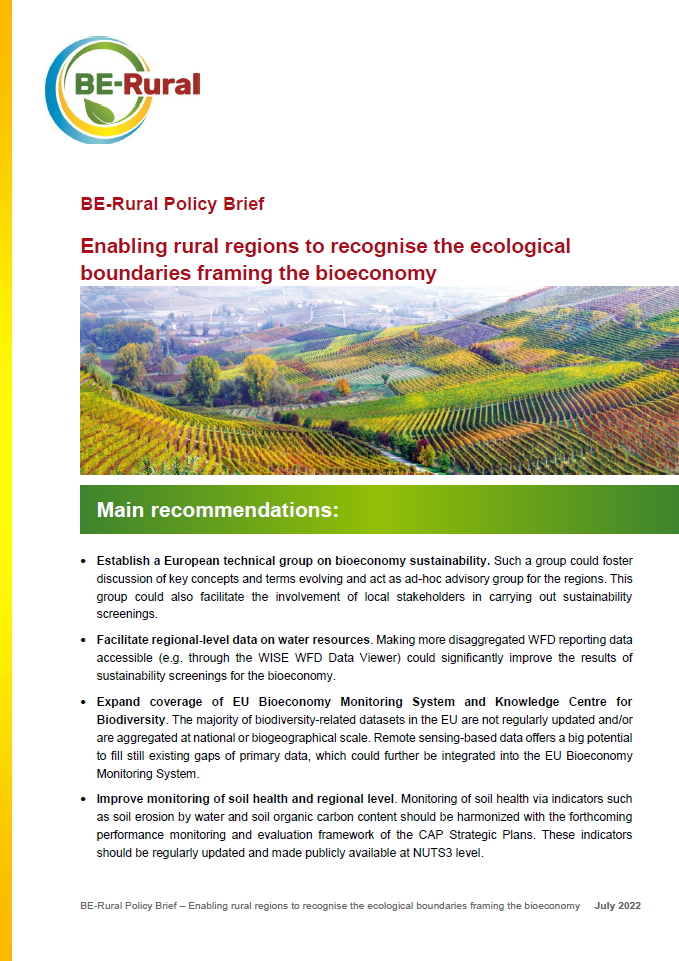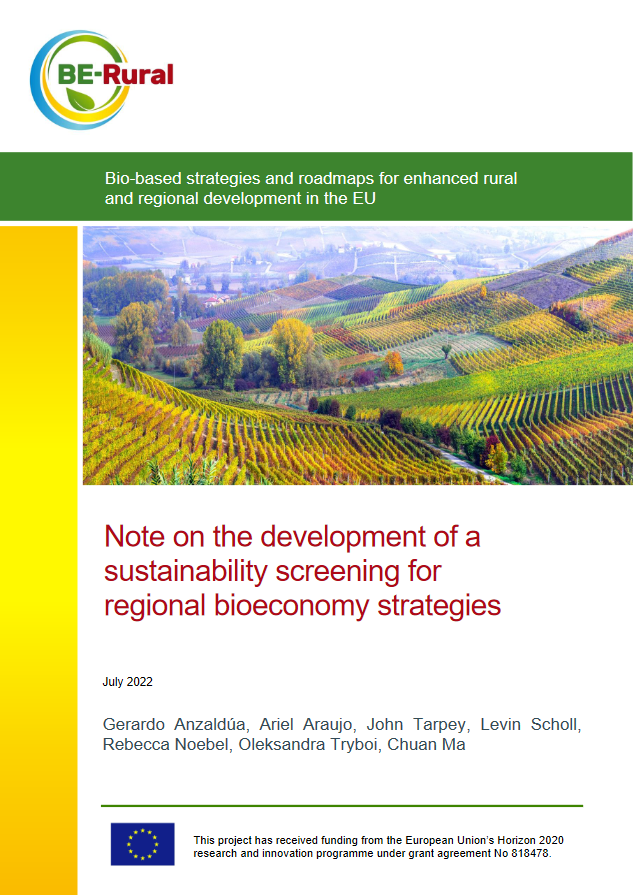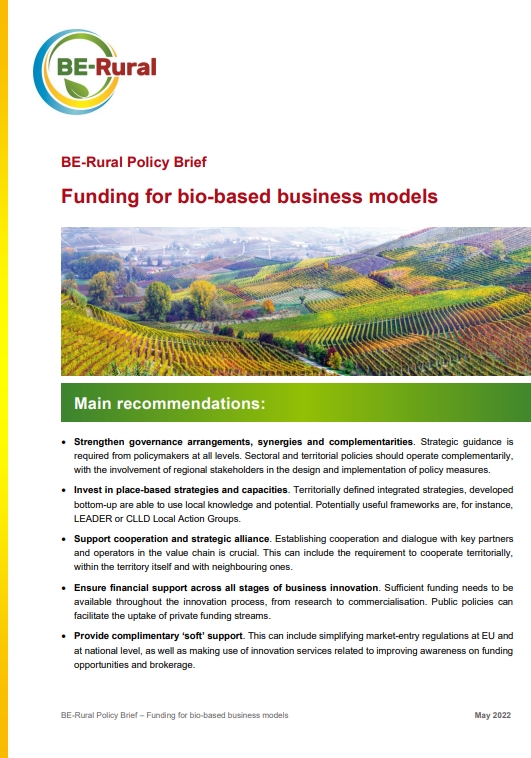Publikation:Bericht
Publikation:Policy Brief
From Strategy to Action for a Regional, Participatory, and Sustainable EU Bioeconomy
Evidence and recommendations from RuralBioUp, SCALE-UP, BioRural, and MainstreamBIO
Jahr
WeiterlesenPublikation:Bericht
Publikation:Policy Brief
Scaling up Biobased Production within Ecological Boundaries
Recommendations for an updated EU Bioeconomy Strategy
Jahr
WeiterlesenPublikation:Policy Brief
Enabling Change from the Ground up
Policy recommendations to foster social innovation in Europe
Jahr
WeiterlesenPublikation:Bericht
Publikation:Bericht
Publikation:Bericht
Publikation:Bericht
Regionalisierte Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung der Unterbodenbewirtschaftung
Evidenz aus Deutschland
Jahr
WeiterlesenPublikation:Policy Brief
Publikation:Bericht
Publikation:Buchkapitel
Publikation:Policy Brief
Publikation:Bericht
Note on the Development of a Sustainability Screening for Regional Bioeconomy Strategies
Deliverable 5.4 H2020 Research project BE-Rural
Jahr
WeiterlesenPublikation:Bericht
The Impact of Subsoil Management on the Delivery of Ecosystem Services
An economic valuation for Germany
Jahr
WeiterlesenPublikation:Policy Brief
Publikation:Bericht
Publikation:Policy Brief