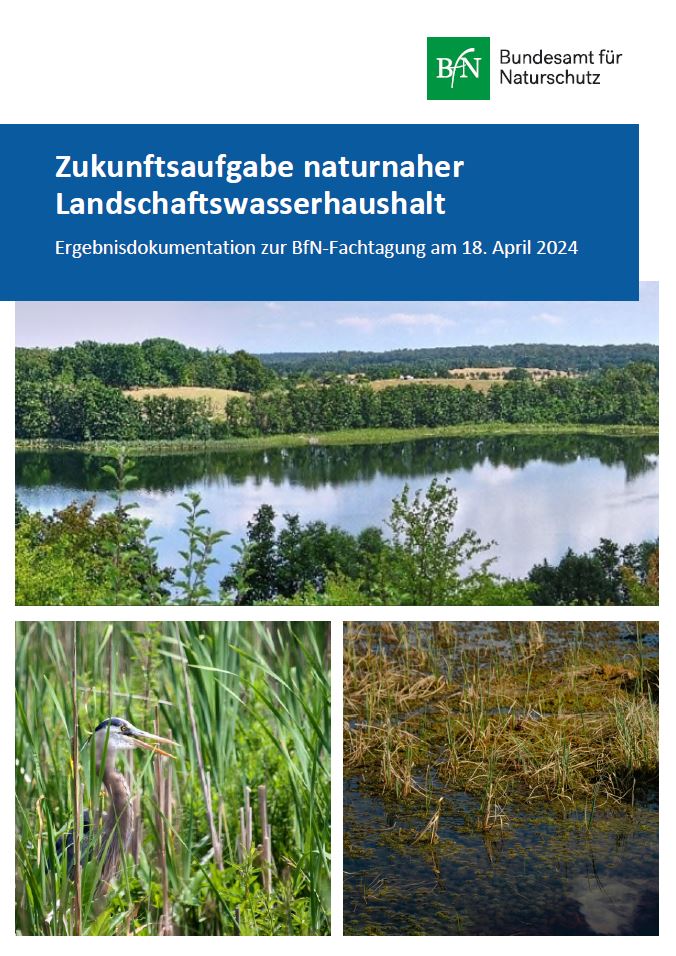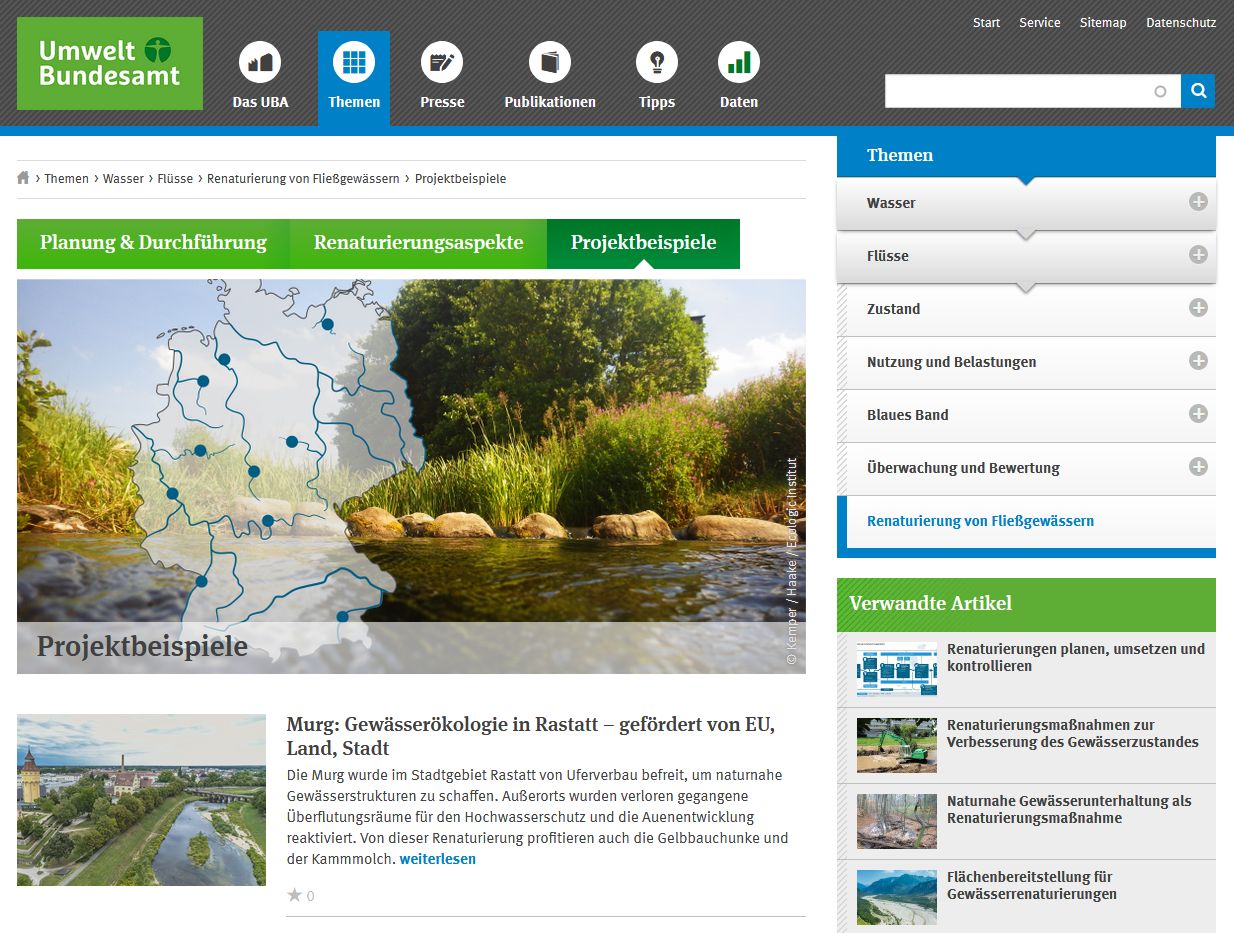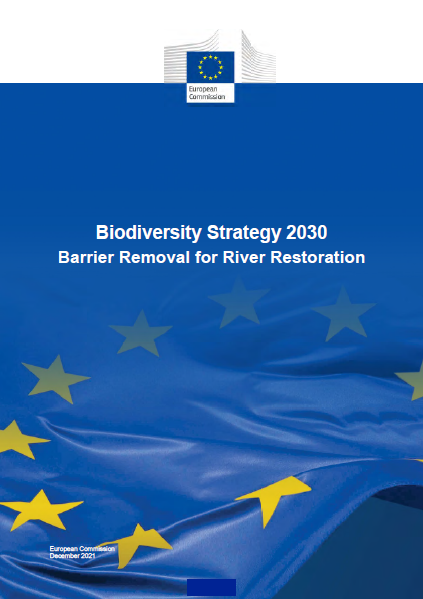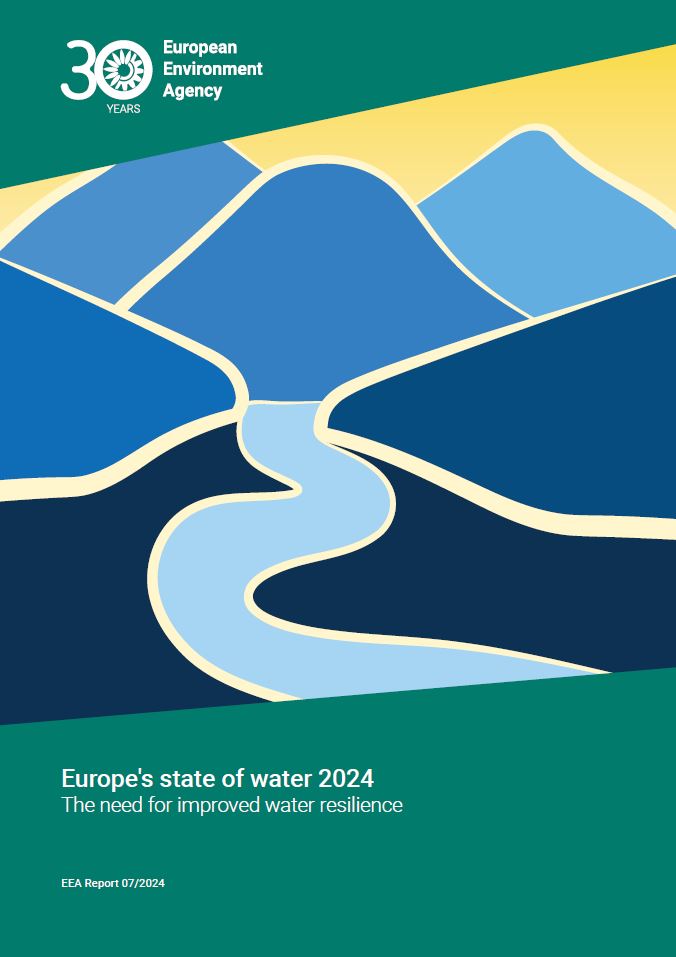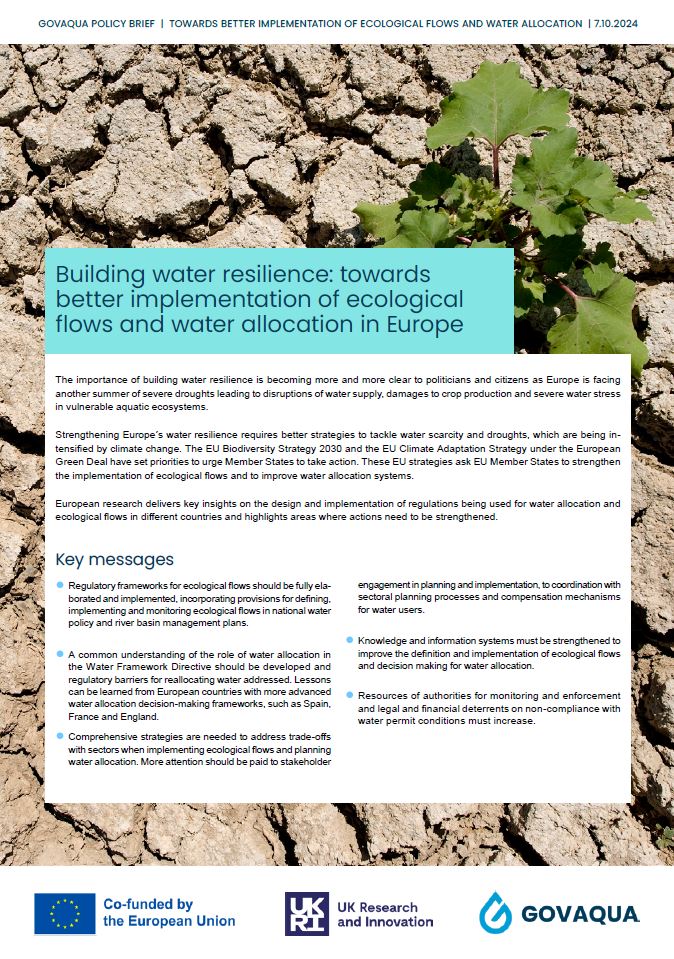© Ecologic Institute, 2025
Wege zu einem naturnahen Landschaftswasserhaushalt
Ecologic Institut bei der DWA-Tagung
- Präsentation
- Datum
-
- Ort
- Essen, Deutschland
- Vortrag
Wie lassen sich Landschaften so gestalten, dass sie Wasser besser speichern, Extremereignisse abpuffern und gleichzeitig zur Biodiversität beitragen? Diese Frage stand im Mittelpunkt von Dr. Benjamin Kupilas Vortrag bei der diesjährigen DWA-Fachtagung "Flussgebietsmanagement".
Ein naturnaher Wasserhaushalt ist weit mehr als ein technisches Thema der Wasserwirtschaft – er ist ein zentrales Element von Klimaschutz und -anpassung, Natur- und Ressourcenschutz. Dürreereignisse und Hochwasser der letzten Jahre haben deutlich gemacht, wie vulnerabel unsere Landschaften und Infrastrukturen sind. Naturnahe Ökosysteme können Wasser besser speichern und erhöhen so die Resilienz ganzer Regionen.
Renaturierung und naturbasierte Lösungen als Schlüssel
Renaturierung von Ökosystemen und Landschaftselementen ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um einen naturnahen Landschaftswasserhaushalt zu entwickeln. Denn wenn wir Auen wieder anschließen, Moore wiedervernässen oder Wälder naturnah entwickeln, dann schaffen wir Rückhalteflächen, Lebensräume und CO₂-Senken – also echte Synergien zwischen Klima-, Natur- und Wasserschutz. Der Landschaftswasserhaushalt ist damit eine klassische Querschnittsaufgabe und erfordert Kooperation, Integration und gemeinsames Handeln über Verwaltungs- und Disziplinengrenzen hinweg. Ziel ist es, verschiedene Disziplinen enger zusammenzubringen – damit Renaturierung nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch gesellschaftlich und wirtschaftlich tragfähig wird.
Forschung, Praxis und Umsetzung verbinden
Aufbauend auf einer vom Ecologic Institut für das Bundesamt für Naturschutz (BfN) im Jahr 2024 organisierten Fachtagung zur Zukunftsaufgabe naturnaher Landschaftswasserhaushalt wurden vier zentrale Forschungsfelder identifiziert:
- Entwicklung regionaler Leitbilder für Schwamm- und Flusslandschaften,
- Erstellung multifunktionale Landnutzungskonzepte,
- Erweiterung des Prozessverständnisses, etwa zur Wechselwirkung zwischen Vegetation, Böden und Wasserverfügbarkeit,
- Etablierung eines belastbaren Monitorings mit zugänglichen Daten.
Zahlreiche Projekte und Modellvorhaben generieren bereits wichtige Erkenntnisse und zeigen, wie etwa naturbasierte Lösungen in unterschiedlichen Landschaften umgesetzt werden können – von Heckenpflanzungen in Agrarlandschaften bis hin zu Schwammstädten mit grünen und blauen Infrastrukturen.
Die zentrale Herausforderung liegt nun darin, dieses Wissen auch wirksam umzusetzen – und zwar in einem komplexen Umfeld aus rechtlichen, planerischen und institutionellen Rahmenbedingungen. Die identifizierten Umsetzungsbedarfe betreffen dabei fünf zentrale Handlungsfelder:
- die konsequente rechtliche und politische Umsetzung bestehender Strategien und Vorgaben,
- die vereinfachte Bereitstellung von Fördermitteln, eine flexible Vertragsgestaltung ergänzt durch Anreize für private (Co-)Finanzierung,
- die Sicherung geeigneter Flächen,
- die Stärkung sektorübergreifender Zusammenarbeit und eine partizipative Prozessgestaltung, um die gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern,
- die konkrete Maßnahmenumsetzung mit begleitender Erfolgskontrolle.
Wege zur Umsetzung
- Synergien erkennen und nutzen: Zwischen den Zielen von Naturschutz, Wasserwirtschaft, Auen- und Gewässerschutz, Klimaschutz und Klimaanpassung bestehen große Synergiepotenziale. Diese gilt es, in der Planung frühzeitig zu erkennen und aktiv zu nutzen. Naturbasierte Lösungen sind dabei das verbindende Element, das ökologische und technische Ansätze zusammenführt.
- Vom Wissen zur Praxis: Wir verfügen heute bereits über ein breites Wissen aus Forschung, Modellprojekten und praktischen Erfahrungen. Die zentrale Herausforderung liegt nun darin, diese Erkenntnisse konsequent in die Umsetzung zu bringen – etwa durch Modellvorhaben zur Planung und Realisierung von Schwammlandschaften, die zeigen, wie Wasser zurückgehalten, Böden aktiviert und Ökosysteme stabilisiert werden können.
- Partizipation als Schlüssel zur Akzeptanz: Um die Transformation hin zu klimaresilienten Landschaften zu gestalten, braucht es partizipative Ansätze. Eine frühzeitige und offene Einbindung lokaler Akteur:innen, Landnutzender und der Bevölkerung stärkt Akzeptanz, schafft Vertrauen und ermöglicht gemeinsam getragene Lösungen.
- Finanzierung langfristig sichern: Für dauerhafte Wirkung braucht es verlässliche, langfristige Finanzierungsstrukturen. Neben öffentlicher Förderung sollten neue Finanzierungsmodelle entwickelt werden – etwa Kofinanzierungen durch private Akteur:innen.