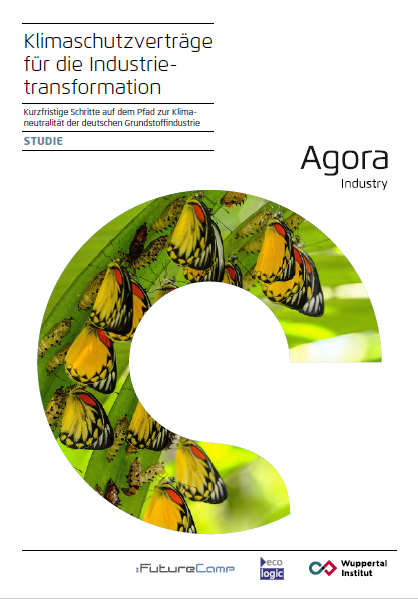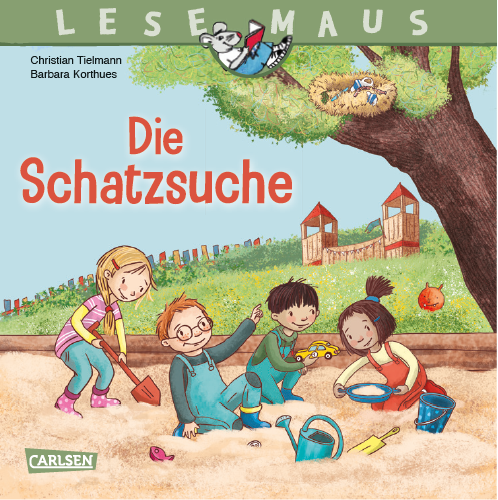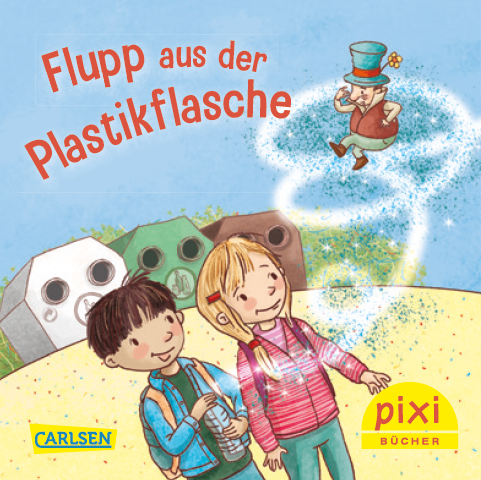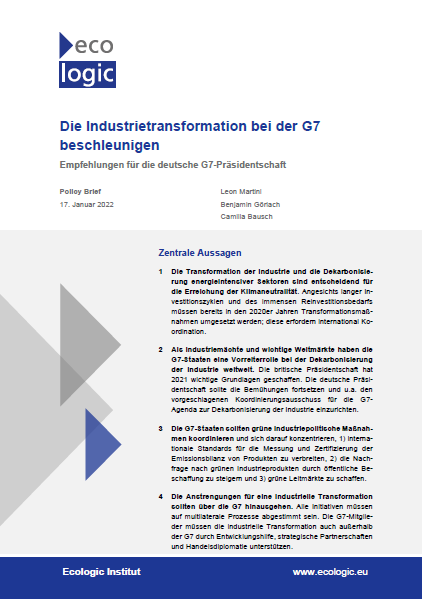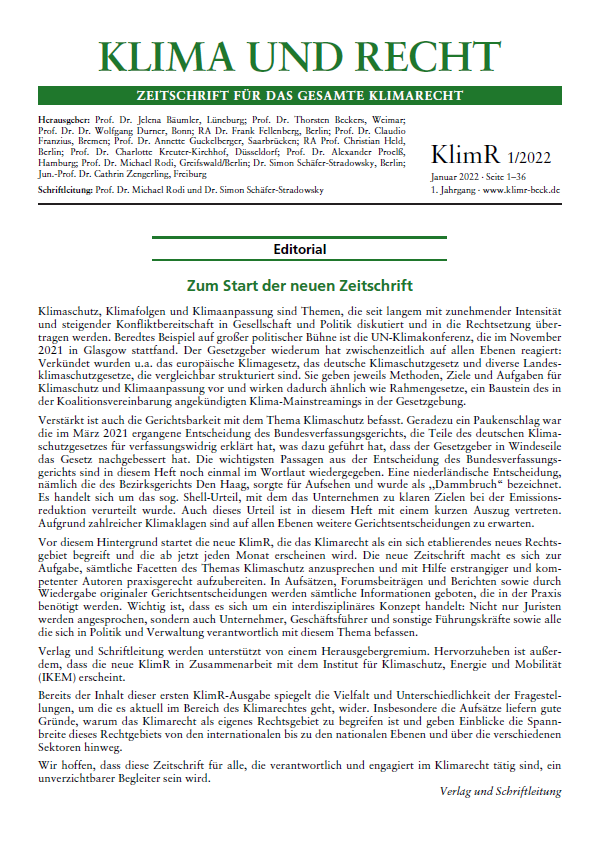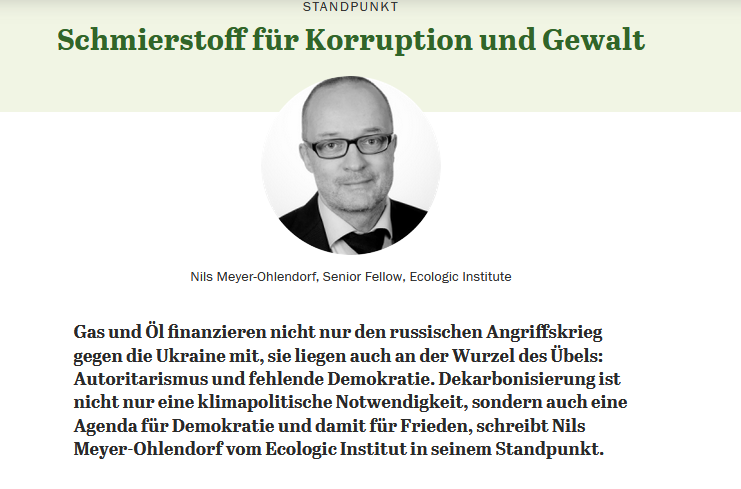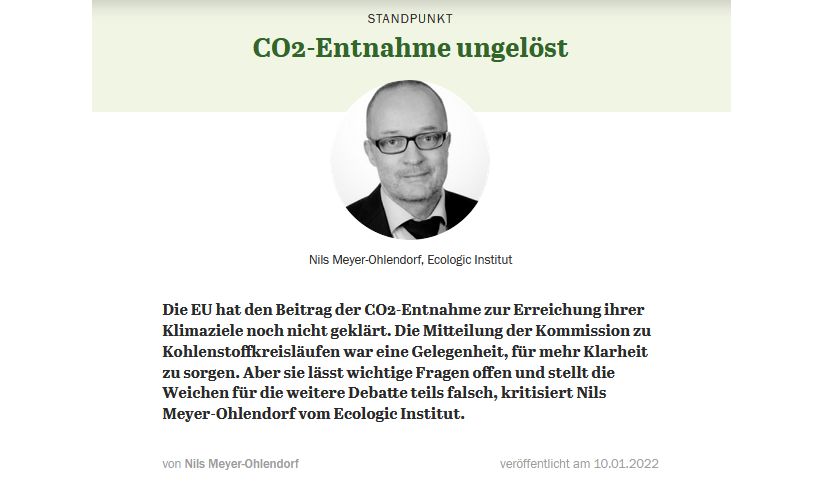Publikation:Infografik
Publikation:Artikel
Publikation:Bericht
Klimaschutzverträge für die Industrietransformation
Kurzfristige Schritte auf dem Pfad zur Klimaneutralität der deutschen Grundstoffindustrie
Jahr
WeiterlesenPublikation:Buch
Publikation:Buch
Publikation:Knowledge for Future – Der Umwelt-Podcast
Gutes Essen für alle! Ernährungswende – Regional Gedacht (4/4)
13. Folge von "Knowledge for Future – Der Umwelt-Podcast"
Jahr
WeiterlesenPräsentation:Vortrag
Präsentation:Interview
Publikation:Policy Brief
Die Industrietransformation bei der G7 beschleunigen
Empfehlungen für die deutsche G7-Präsidentschaft
Jahr
WeiterlesenPräsentation:Vortrag
Publikation:Dokument
Publikation:Konferenzpapier
Online-Expert*innenworkshop am 30.11.2021 "Ziele und Indikatoren für die Proteinwende in Deutschland"
Ergebnisdokumentation
Jahr
WeiterlesenPublikation:Artikel
Publikation:Artikel
Publikation:Artikel